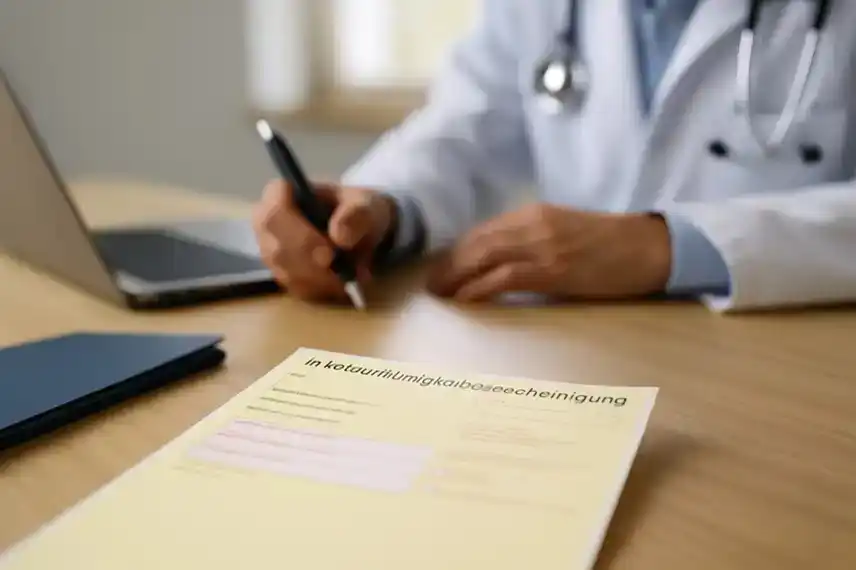
Berlin. Die Diskussion um die Vorlagefrist für Krankschreibungen sorgt für Spannungen zwischen Arbeitgebern und Ärzteschaft. Während die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) eine spätere Vorlagepflicht fordert, laufen Arbeitgeberverbände Sturm gegen den Vorschlag. Im Zentrum steht die Frage: Wie viel Vertrauen ist im Krankheitsfall angemessen – und wer trägt am Ende die Kosten?
Gesetzliche Grundlage: Was aktuell für Arbeitnehmer gilt
Der Kern der Debatte liegt im Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5 EFZG). Dieses schreibt vor, dass Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber spätestens nach drei Kalendertagen der Arbeitsunfähigkeit ein ärztliches Attest vorlegen müssen – also am vierten Tag der Krankheit. Allerdings besitzt der Arbeitgeber das Recht, die Vorlage auch früher zu verlangen, selbst ohne konkreten Verdacht auf Missbrauch.
Seit Januar 2023 hat sich die Praxis durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verändert. Arbeitnehmer müssen dem Arbeitgeber keine Papierbescheinigung mehr übergeben. Stattdessen ruft der Arbeitgeber die Daten direkt bei der Krankenkasse ab. Dennoch bleibt die Pflicht bestehen, die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer „unverzüglich“ zu melden. Damit wird aus der früheren Bringschuld eine Holschuld des Arbeitgebers gegenüber der Krankenkasse.
Wann muss eine Krankschreibung vorgelegt werden?
Viele Arbeitnehmer fragen sich: „Ab welchem Krankheitstag muss ich eine Krankschreibung vorlegen?“ – Die Antwort bleibt eindeutig: spätestens am vierten Kalendertag, sofern der Arbeitgeber keine frühere Vorlage verlangt. Bei besonderen betrieblichen Regelungen oder bei wiederholten Kurzzeiterkrankungen kann das Attest auch ab dem ersten Tag gefordert werden.
Der Reformvorschlag der KBV: Bürokratieabbau oder Sicherheitsrisiko?
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlug im Oktober 2025 vor, die Pflicht zur Vorlage einer Krankschreibung auf den vierten oder fünften Krankheitstag zu verschieben. Ziel sei es, unnötige Arztbesuche zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand zu senken. Die KBV argumentiert, dass viele Erkrankungen – insbesondere Erkältungen oder Magen-Darm-Infekte – bereits nach zwei bis drei Tagen abklingen und ein Arztbesuch in diesen Fällen überflüssig sei.
„Wir brauchen mehr Vertrauen in die Selbstverantwortung der Beschäftigten“, heißt es seitens der KBV. Die aktuelle Regelung belaste sowohl Arztpraxen als auch Patienten durch zusätzliche Termine, die keine medizinische Notwendigkeit hätten.
Arbeitgeber laufen Sturm gegen die geplante Änderung
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) lehnt den Vorschlag entschieden ab. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter bezeichnete die Initiative als „Nebelkerze“. Eine spätere Vorlage löse keine der strukturellen Probleme im Gesundheitswesen, sondern schiebe nur die Verantwortung zwischen Arbeitgebern und Ärzten hin und her. Stattdessen fordert die BDA eine stärkere Steuerung der Patientenströme, um Kosten und Effizienz besser zu kontrollieren.
Arbeitgeber befürchten, dass eine verlängerte Frist die Kontrolle über Krankmeldungen schwächt und Missbrauch erleichtert. Außerdem könnte die Lohnfortzahlungspflicht bei fehlendem Nachweis zur finanziellen Belastung werden. Laut Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) beliefen sich die Kosten für Lohnfortzahlung bei Krankheit im Jahr 2025 auf rund 82 Milliarden Euro – Tendenz steigend.
Steigende Krankheitszahlen und wirtschaftliche Folgen
Seit Beginn der 2020er Jahre ist der Krankenstand in Deutschland stetig gestiegen. Besonders seit der Corona-Pandemie sind sowohl die Häufigkeit als auch die Dauer von Krankheitsfällen deutlich höher. Das IW Köln spricht von einem „außergewöhnlichen Niveausprung“. Gründe seien neben viralen Erkrankungen auch psychische Belastungen und der demografische Wandel.
Für Unternehmen bedeutet dies eine erhebliche wirtschaftliche Herausforderung. Nicht nur steigen die Kosten durch Entgeltfortzahlung, auch der Organisationsaufwand nimmt zu. Fehlzeiten führen zu Produktionsausfällen, erhöhter Arbeitsbelastung der Kollegen und steigender Fehlerquote. In der Folge wird das Thema Krankmeldung zunehmend zu einem betriebswirtschaftlichen Faktor.
Verlängerte Vorlagefristen – ein Risiko für Unternehmen?
Die Gegner der Reform argumentieren, dass eine spätere Vorlagepflicht Arbeitgebern den Überblick erschwere. Sie hätten weniger Möglichkeiten, frühzeitig Ersatz zu organisieren oder Zweifel an einer Krankmeldung zu äußern. „Das Vertrauen darf nicht blind sein“, warnte ein Sprecher der BDA. Gerade in kleineren Betrieben könne bereits eine einzelne, ungedeckte Krankmeldung den Betrieb erheblich beeinträchtigen.
Andererseits verweisen Arbeitnehmervertreter auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit: Die Mehrheit der Beschäftigten nutze das System verantwortungsvoll. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der BDA gaben 83 Prozent der Befragten an, im letzten Jahr mindestens einmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt zu haben – meist aus ehrlicher Notwendigkeit.
Digitale Krankschreibung und ihre Tücken
Mit der Einführung der eAU wurde das System modernisiert, doch die Umstellung verlief nicht reibungslos. In Foren und Personal-Communities häufen sich Berichte über technische Ausfälle oder Übermittlungsfehler. In solchen Fällen kann die digitale Bescheinigung nicht abgerufen werden – und es bleibt unklar, ob Arbeitnehmer trotzdem sanktioniert werden dürfen.
Personalverantwortliche in der HR-Community „Personio“ berichten etwa, dass eAUs teilweise mit mehreren Tagen Verzögerung erscheinen. Diese Unsicherheit verschärft die Diskussion: Wenn Arbeitgeber auf ein funktionierendes digitales System angewiesen sind, gleichzeitig aber Fristen verschoben werden, droht ein Kontrollverlust.
Kann mein Arbeitgeber ein Attest schon am ersten Tag verlangen?
Ja – allerdings nur, wenn dies im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder durch Einzelfallanordnung geregelt ist. Das Bundesarbeitsgericht hat in mehreren Urteilen bestätigt, dass Arbeitgeber diese Anordnung auch ohne besonderen Anlass treffen dürfen. Kritiker sehen darin jedoch eine potenzielle Ungleichbehandlung, wenn einzelne Mitarbeiter gezielt früher ein Attest vorlegen müssen.
Teilkrankschreibung und Karenztag: Neue Ideen im Gesundheitsdialog
Im Zuge der aktuellen Diskussion taucht ein weiterer Vorschlag auf: die Wiedereinführung eines sogenannten Karenztages. Dabei würde der Anspruch auf Lohnfortzahlung erst ab dem zweiten oder dritten Krankheitstag greifen – eine Idee, die vor allem in skandinavischen Ländern verbreitet ist. Befürworter argumentieren, dass dies spontane, unbegründete Krankmeldungen reduzieren könnte. Gegner halten dagegen, dass es Menschen mit geringem Einkommen überproportional belaste.
Parallel wird über die Einführung von Teilkrankschreibungen diskutiert. Diese sollen es ermöglichen, dass Arbeitnehmer – etwa nach einer Operation oder bei chronischen Beschwerden – stundenweise arbeiten können. So ließe sich die Produktivität erhalten, während der Genesungsprozess unterstützt wird. Der Deutschlandfunk berichtete, dass diese Idee in Fachkreisen zunehmend Unterstützung findet, auch wenn es bisher keine gesetzliche Grundlage dafür gibt.
Wie können Arbeitgeber bei Zweifeln reagieren?
Bestehen berechtigte Zweifel an einer Krankmeldung, kann der Arbeitgeber den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) einschalten. Dieser überprüft, ob die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich besteht. Außerdem können Arbeitgeber bei wiederholtem oder auffälligem Verhalten (z. B. Krankmeldungen vor Feiertagen) individuelle Prüfungen anstoßen. Erfolgt die Vorlage der Krankschreibung verspätet, darf die Entgeltfortzahlung verweigert werden, sofern der Arbeitnehmer keinen glaubhaften Nachweis erbringt.
Rechtliche Stolperfallen und Arbeitnehmerrechte
Viele Beschäftigte fragen sich: „Was passiert, wenn ich das Attest verspätet einreiche?“ – In diesem Fall kann der Arbeitgeber tatsächlich Sanktionen verhängen. Eine Abmahnung ist zulässig, wenn die verspätete Abgabe gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstößt. Kommt dies wiederholt vor, droht im Extremfall sogar eine verhaltensbedingte Kündigung.
Gleichzeitig darf der Arbeitgeber nicht alles wissen: Die Diagnose bleibt vertraulich. Nur die Dauer und Art der Arbeitsunfähigkeit (z. B. „arbeitsunfähig wegen Krankheit“) werden mitgeteilt. Das Recht auf Datenschutz gilt auch im Krankheitsfall und darf nicht untergraben werden.
Telefonische Krankschreibung und Vertrauensfrage
Seit Ende 2023 ist die telefonische Krankschreibung dauerhaft erlaubt. Bei leichten Atemwegserkrankungen oder Erkältungen können Ärzte eine AU auch ohne persönlichen Kontakt ausstellen. Die elektronische Übermittlung erfolgt automatisch – was einerseits entlastet, andererseits neue Herausforderungen für die Kontrolle bringt. Arbeitgebervertreter befürchten hier eine „Grauzone des Vertrauens“, während Befürworter auf mehr Flexibilität verweisen.
Meinungen aus der Praxis: Zwischen Vertrauen und Kontrolle
In sozialen Netzwerken wie Reddit und gutefrage.net wird die Frage der Krankmeldung emotional diskutiert. Viele Nutzer berichten von Misstrauen seitens ihrer Vorgesetzten. In einem Reddit-Beitrag schildert ein Angestellter, dass sein Chef bereits am ersten Krankheitstag ein Attest verlangt – trotz leichter Erkältung. Die Community reagiert geteilt: Einige sehen es als nachvollziehbar, andere als Ausdruck von Misstrauen.
Auf gutefrage.net wiederum wird über Fälle diskutiert, in denen nur einzelne Mitarbeiter zur früheren Vorlage verpflichtet wurden. Arbeitsrechtler weisen darauf hin, dass solche Einzelanordnungen zwar zulässig, aber an klare Gleichbehandlungsgrundsätze gebunden sind.
Wie sich das Vertrauen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entwickeln könnte
Die Debatte über die Vorlagefrist ist letztlich mehr als eine juristische Frage – sie berührt das Grundverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Arbeitgeberseite fürchtet Kontrollverlust und steigende Kosten, während die Ärzteschaft auf Bürokratieabbau drängt. Arbeitnehmer wiederum wünschen sich mehr Vertrauen und weniger Misstrauenskultur.
Ob der KBV-Vorschlag politische Umsetzung findet, bleibt offen. Arbeitsministerien und Verbände prüfen derzeit die möglichen Folgen. Klar ist: Ein einfaches „Später-vorlegen-und-Problem-gelöst“ wird es nicht geben. Die Balance zwischen Effizienz, Vertrauen und Kontrolle bleibt eine der größten Herausforderungen moderner Arbeitsbeziehungen.
Einordnung und Ausblick: Warum die Krankmeldung bleibt, was sie ist – ein sensibles Gleichgewicht
Die Diskussion um die spätere Vorlagepflicht zeigt, wie stark Arbeitsrecht, Gesundheitssystem und Wirtschaft ineinandergreifen. Die Krankmeldung ist nicht nur ein Dokument, sondern ein Symbol für Vertrauen und Verantwortung. Wenn Arbeitgeber mehr Kontrolle verlangen, während Arbeitnehmer um Selbstbestimmung ringen, spiegelt das eine tiefergehende gesellschaftliche Dynamik wider.
Langfristig könnte sich die Lösung in der Digitalisierung finden – vorausgesetzt, Systeme wie die eAU funktionieren zuverlässig. Transparenz, Fairness und Kommunikation sind entscheidend, damit aus Misstrauen wieder Vertrauen wird. Bis dahin bleibt die Krankmeldung ein sensibles Thema – rechtlich klar geregelt, aber menschlich umstritten.

































