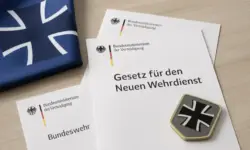Die Diskussion über die Erbschaftsteuer nimmt in Deutschland Fahrt auf. Während das Statistische Bundesamt steigende Steuerfestsetzungen meldet, zeigen neue Auswertungen, dass gerade große Vermögen häufig kaum oder gar nicht besteuert werden. Kritiker sehen darin eine wachsende Ungerechtigkeit, Befürworter warnen vor Risiken für den Wirtschaftsstandort. Ein Überblick über Daten, Hintergründe und aktuelle Debatten.
Steigende Festsetzungen, aber niedrige reale Einnahmen
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im Jahr 2024 rund 13,3 Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer festgesetzt – ein Plus von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein die Erbschaftsteuer machte dabei 8,5 Milliarden Euro aus. Diese Zahlen deuten zunächst auf einen erheblichen fiskalischen Beitrag hin. Doch was auf den ersten Blick nach Rekordeinnahmen aussieht, relativiert sich bei genauerem Hinsehen.
Denn die kassenmäßigen Einnahmen – also das, was der Staat tatsächlich einnimmt – liegen spürbar darunter. Studien zeigen, dass die realen Einnahmen in einzelnen Jahren mehrere Milliarden Euro unter den Festsetzungen lagen. Der Grund: umfangreiche Steuererlasse und Privilegien, die gerade bei sehr großen Erbschaften greifen.
Die Verschonungsbedarfsprüfung als Hebel
Ein zentrales Instrument ist die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG. Sie erlaubt einen teilweisen oder sogar vollständigen Erlass der Steuer, wenn der Erbe nicht genügend Privatvermögen besitzt, um die Steuerlast zu begleichen. Besonders relevant wird diese Regelung bei Erbschaften über 26 Millionen Euro.
Eine Auswertung zivilgesellschaftlicher Organisationen zeigte, dass 2024 allein 45 Großerben begünstigt wurden. Auf ein Gesamtvermögen von rund 12 Milliarden Euro wurden zunächst 3,5 Milliarden Euro Steuern festgesetzt. Tatsächlich gezahlt wurden davon am Ende nur etwa 180 Millionen Euro – eine effektive Belastung von rund 1,5 Prozent. Dieser Mechanismus erklärt, warum große Vermögen trotz hoher Nominalwerte oft nahezu steuerfrei übertragen werden können.
Betriebsvermögen unter besonderem Schutz
Ein weiterer Kernbereich der Privilegien ist das Betriebsvermögen. Schon seit Jahren gilt: Wer ein Unternehmen erbt, kann unter bestimmten Voraussetzungen 85 Prozent oder sogar 100 Prozent des Werts steuerfrei übertragen. Die Bedingung: Das Unternehmen muss über fünf beziehungsweise sieben Jahre fortgeführt werden. Ergänzt wird dies durch Vorgaben zur Lohnsumme und zum Anteil schädlichen Verwaltungsvermögens.
Für extrem hohe Werte jenseits von 26 Millionen Euro gilt das sogenannte Abschmelzmodell. Alternativ kann jedoch ebenfalls die Verschonungsbedarfsprüfung genutzt werden. Kritiker weisen darauf hin, dass diese Ausnahmen ursprünglich für kleine und mittlere Unternehmen gedacht waren, inzwischen jedoch auch von großen Unternehmensgruppen genutzt werden. Damit, so die Kritik, werde der eigentliche Zweck der Regelungen verwässert.
Frage: Welche Steuervergünstigungen gelten bei Unternehmensnachfolge?
Die gängigsten Vergünstigungen sind die Regelverschonung von 85 Prozent und die Optionsverschonung von 100 Prozent für Betriebsvermögen. Diese greifen, wenn das Unternehmen fortgeführt wird und die gesetzlichen Auflagen erfüllt sind. Bei sehr großen Unternehmensübertragungen können zusätzliche Mechanismen wie die Verschonungsbedarfsprüfung beantragt werden. Dadurch bleibt die Steuerlast bei vielen Nachfolgeregelungen minimal.
Kritik und internationale Vergleiche
Deutschland verfügt formal über ein progressives Erbschaftsteuersystem mit Freibeträgen, die nach Verwandtschaftsgrad gestaffelt sind. Ehegatten können bis zu 500.000 Euro steuerfrei erben, Kinder 400.000 Euro, während entfernte Verwandte oder Freunde deutlich weniger Freibeträge haben. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass gerade große Vermögen systematisch entlastet werden.
Im internationalen Vergleich fällt auf: Während Länder wie Frankreich, Belgien oder die USA in bestimmten Fällen eine deutlich höhere Belastung großer Nachlässe kennen, schöpft Deutschland sein Potenzial kaum aus. Schätzungen zufolge liegt die effektive Besteuerung großer Erbschaften bei durchschnittlich etwa drei Prozent. Gleichzeitig ist die Belastung von Arbeitseinkommen im internationalen Vergleich hoch. Die OECD fordert daher, die Steuerlast stärker von Arbeit hin zu Kapital- und Vermögenseinkommen zu verlagern.
Frage: Welche Kritik gibt es an den Privilegien für Superreiche?
Die gängigsten Kritikpunkte sind: Erstens entgehen dem Staat durch Steuererlasse und Vergünstigungen Einnahmen in Milliardenhöhe. Zweitens widerspricht es dem Prinzip der Leistungsfähigkeit, wenn große Vermögen kaum belastet werden, während Arbeitseinkommen deutlich höher besteuert werden. Drittens sehen Kritiker eine wachsende Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Viele Regelungen, die zum Schutz kleiner Betriebe gedacht waren, kommen heute vor allem Großunternehmen zugute.
Das Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand
Schon zweimal hat das Bundesverfassungsgericht die Erbschaftsteuer in den vergangenen Jahrzehnten gerügt: 2006 und 2014. Beide Male wurden Änderungen verlangt, um übermäßige Privilegierungen zu verhindern. Auch die Reform von 2016 steht mittlerweile in der Kritik. Für 2025 sind neue Entscheidungen des Gerichts angekündigt, die erneut grundlegende Teile des Erbschaftsteuerrechts betreffen könnten. Damit bleibt das Thema hochaktuell und könnte in naher Zukunft zu Reformen führen.
Stimmen aus den sozialen Medien
In Foren und sozialen Netzwerken zeigt sich die Unzufriedenheit vieler Nutzerinnen und Nutzer. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Ist schon perfide, je mehr man hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit weniger zu zahlen.“ Andere beklagen, dass ohne Erbschaft kaum Chancen auf Eigentum bestünden, während große Vermögen unantastbar blieben. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Diskussionen über legale Wege, Erbschaftsteuer zu vermeiden – etwa durch frühzeitige Schenkungen oder das geschickte Ausschöpfen von Freibeträgen.
Diese Stimmen zeigen, dass die Erbschaftsteuer nicht nur ein rechtliches und ökonomisches Thema ist, sondern auch ein gesellschaftliches. Es geht um die Frage, ob die Steuerpolitik mit den Prinzipien von Gerechtigkeit und Chancengleichheit in Einklang steht.
Frage: Was bedeutet die Verschonungsbedarfsprüfung konkret?
Die Verschonungsbedarfsprüfung wird angewendet, wenn das Vermögen des Erben so strukturiert ist, dass zwar ein großer Wert vererbt wird, aber nicht genug liquides Privatvermögen vorhanden ist, um die Steuer zu zahlen. In diesem Fall kann ein Antrag gestellt werden, die Steuer ganz oder teilweise zu erlassen. Der Gedanke dahinter: Unternehmen sollen nicht zerschlagen werden, nur um die Steuerlast zu begleichen. In der Praxis führt dies jedoch dazu, dass auch sehr reiche Erben große Summen nahezu steuerfrei übertragen können.
Reale Beispiele und Zahlen
Die Zahlen des Jahres 2024 sprechen eine klare Sprache: Auf ein Volumen von rund 12 Milliarden Euro begünstigter Erbschaften wurden zunächst 3,5 Milliarden Euro Steuer festgesetzt. Davon erließ der Staat später etwa 3,3 Milliarden Euro. Nur rund 180 Millionen Euro flossen tatsächlich in die Kassen. Diese Diskrepanz macht deutlich, dass nominale Festsetzungen wenig über die reale Belastung aussagen.
Ein weiterer Befund: Fast 88 Prozent der Erben von Firmenvermögen zahlen laut Schätzungen gar keine Erbschaftsteuer. Damit wird deutlich, wie stark die Regelungen die tatsächliche Steuerbelastung verschieben.
Frage: Wie hoch sind die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer?
Die Freibeträge hängen vom Verwandtschaftsgrad ab. Ehepartner und eingetragene Lebenspartner haben Anspruch auf 500.000 Euro steuerfrei. Kinder können 400.000 Euro steuerfrei erben. Enkel profitieren, wenn die Eltern bereits verstorben sind, ansonsten ist ihr Freibetrag niedriger. Für Geschwister, Nichten, Neffen oder Freunde liegt der Freibetrag deutlich geringer – häufig nur bei 20.000 Euro.
Immobilien und Eigenheimregelungen
Ein spezieller Bereich ist das selbst genutzte Wohneigentum. Unter bestimmten Bedingungen bleibt es steuerfrei, wenn der Erbe es selbst bewohnt und die Größe bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Wird die Immobilie jedoch nicht genutzt oder zeitnah verkauft, entfällt diese Steuerbefreiung. Das sorgt in der Praxis immer wieder für Diskussionen, da viele Erben durch diese Regelung überrascht werden.
Frage: Ist selbst genutztes Wohneigentum steuerfrei?
Ja, wenn es sich um die selbst bewohnte Immobilie des Erblassers handelt und der Erbe sie nach dem Erwerb weiterhin selbst nutzt. Die Steuerbefreiung entfällt jedoch, wenn das Objekt nicht selbst genutzt oder innerhalb von zehn Jahren verkauft wird. Diese Befreiung gilt allerdings nur für bestimmte Verwandtschaftsgrade, nicht für entfernte Erben.
Ungleichheit und politische Debatte
Die politische Debatte dreht sich um die Frage, ob die bestehenden Regelungen gerecht sind. Während Wirtschaftsverbände betonen, dass Unternehmen vor einer Zerschlagung geschützt werden müssen, fordern andere Stimmen eine gerechtere Verteilung der Steuerlast. Die Friedrich-Ebert-Stiftung weist etwa auf Milliardensubventionen hin, die durch die Privilegien entstehen, während Arbeitseinkommen kaum vergleichbare Begünstigungen genießen.
Zudem zeigen internationale Organisationen wie die OECD, dass Deutschland im internationalen Vergleich nur einen geringen Anteil des Vermögens über die Erbschaftsteuer abschöpft. Das Potenzial, Ungleichheiten abzufedern und zusätzliche Einnahmen zu generieren, wird so kaum genutzt.
Frage: Wie wird das verfügbare Vermögen bei der Bedarfsprüfung berechnet?
Verfügbares Vermögen umfasst das Privatvermögen des Erben, das für die Steuerzahlung eingesetzt werden könnte. Dabei wird ein Teil – in der Regel die Hälfte – herangezogen. Verbindlichkeiten können abgezogen werden. Reicht dieses Vermögen nicht aus, kann ein Antrag auf Steuererlass gestellt werden. Genau diese Mechanik führt dazu, dass große Erbschaften in vielen Fällen kaum oder gar nicht besteuert werden.
Schlussgedanken
Die Diskussion um die Erbschaftsteuer in Deutschland berührt ökonomische, rechtliche und gesellschaftliche Dimensionen gleichermaßen. Während kleine und mittlere Erbschaften von klaren Freibeträgen profitieren, zeigen Zahlen und Analysen, dass vor allem sehr große Vermögen durch Privilegien nahezu steuerfrei übertragen werden können. Damit stellt sich die Frage, ob das System noch zeitgemäß ist und ob es den Grundsätzen von Gerechtigkeit und fiskalischer Leistungsfähigkeit entspricht.
Ob das Bundesverfassungsgericht 2025 erneut einschreiten wird und wie sich die Politik positioniert, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Erbschaftsteuer ist mehr als eine fiskalische Stellschraube – sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Vorstellungen von Fairness, Chancengleichheit und Verantwortung zwischen den Generationen.