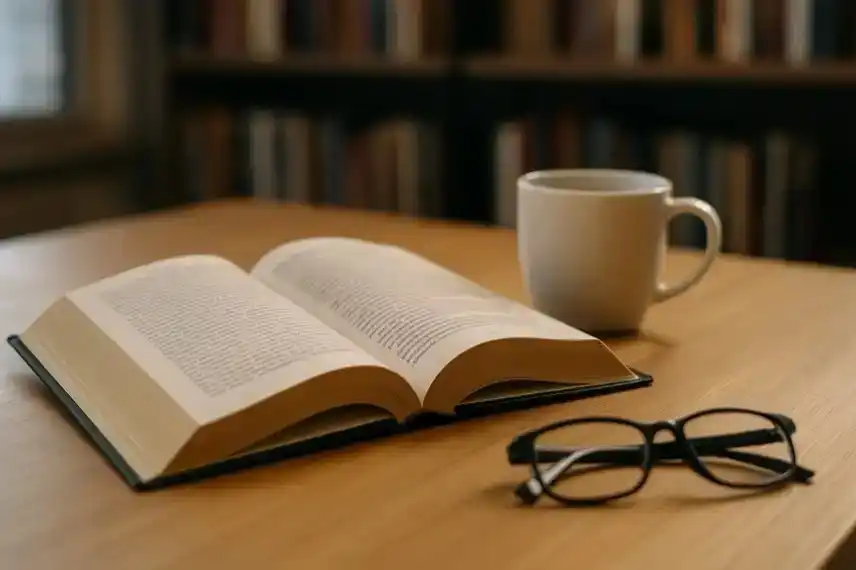Citizen Science trifft Klimaschutz: Das Projekt „CycleSense“
Die Initiative „CycleSense“ ist ein Paradebeispiel für partizipative Forschung, bei der Bürgerinnen und Bürger aktiv in wissenschaftliche Prozesse eingebunden werden. In diesem Fall handelt es sich um eine groß angelegte Messkampagne zur Feinstaubbelastung in Karlsruhe – durchgeführt von freiwilligen Radfahrerinnen und Radfahrern, die mit speziell entwickelten Sensoren ausgestattet sind. Diese erfassen während der Fahrt die Konzentration von Feinstaubpartikeln (PM2,5 und PM10) und übermitteln die Daten an eine zentrale Plattform zur Analyse und Auswertung.
Hinter dem Projekt stehen unter anderem Schüler des Lessing-Gymnasiums, die gemeinsam mit der Karlsruher Technik-Initiative TECHNIKA und regionalen Partnern die Sensorik entwickelt haben. Gefördert wird das Ganze von der Stiftung Baden-Württemberg im Rahmen des Programms „Klimaschutz selber machen“.
Technik am Fahrradlenker: Sensorik für die Straße
Im Zentrum der Messung steht der Sensor SDS011, ein günstiger, aber bewährter Partikelsensor, der in zahlreichen Citizen-Science-Projekten weltweit zum Einsatz kommt. Er misst die Konzentration feiner Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern (PM2,5) und 10 Mikrometern (PM10). Diese Werte gelten als wichtige Indikatoren für die Luftqualität, da sie tief in die Atemwege eindringen und gesundheitsschädlich wirken können.
Der Sensor ist verbunden mit einer Arduino-Plattform, über die Daten erfasst und per Mobilgerät oder Bluetooth-Anbindung übertragen werden. Die Geräte sind leicht, robust und benötigen nur wenig Strom – perfekt für den Einsatz auf Fahrrädern im Stadtverkehr.
Warum Feinstaub ein Problem ist – und gerade in Städten
Feinstaub zählt laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu den vier wichtigsten umweltbedingten Todesursachen weltweit. Die kleinen Partikel gelangen über Abgase, Bremsabrieb, Heizungen oder Baustellen in die Luft und können bei chronischer Belastung zu Lungen-, Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen führen. Gerade in urbanen Räumen wie Karlsruhe, wo hohe Verkehrsdichte und enge Straßenschluchten zusammentreffen, ist die Belastung häufig überdurchschnittlich.
Karlsruhes bisherige Datenlage
Bisher stützte sich die Stadt auf stationäre Messpunkte, die jedoch nur punktuelle Daten liefern. Die mobilen Sensoren auf Fahrrädern ermöglichen erstmals eine dichte, räumlich differenzierte Darstellung der Feinstaubbelastung. Besonders stark betroffene Straßenzüge, Ampelbereiche oder Industriegebiete lassen sich nun gezielt identifizieren – und gegebenenfalls städtebaulich oder verkehrstechnisch optimieren.
Eine Idee von Schülern – und ein ganzer Stadtteil macht mit
Ursprung des Projekts war die Initiative dreier ehemaliger Schüler, die mit der Idee bei „Jugend forscht“ antraten. Ihre Vision: eine erschwingliche, praktikable Lösung für Bürgerinnen und Bürger, um selbst zur Verbesserung der Umwelt beizutragen. Die Begeisterung war ansteckend – inzwischen unterstützen auch Hochschulen, Umweltgruppen und lokale Unternehmen die Aktion.
„Tolle Idee! Endlich zeigt sich, wo’s beim Radeln richtig dreckig ist.“ – Kommentar aus einer lokalen Facebook-Gruppe
Solche Rückmeldungen aus sozialen Netzwerken zeigen, wie hoch das Interesse der Bevölkerung ist – und wie bereit viele sind, aktiv mitzumachen.
Wie valide sind die Messungen?
Zwar liefern die günstigen SDS011-Sensoren keine absolut exakten Werte wie staatlich zertifizierte Messstationen, doch Studien belegen, dass sie unter idealen Bedingungen mit hoher Genauigkeit Trends und Hotspots erfassen können. Wichtig sind jedoch regelmäßige Kalibrierungen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit oder extremer Temperatur.
Stärken der mobilen Messstrategie:
- Große räumliche Abdeckung im städtischen Raum
- Messung im direkten Aufenthaltsumfeld der Bürger
- Transparenz und Offenheit durch öffentliche Datenschnittstellen
- Bewusstseinsbildung durch persönliche Beteiligung
Feinstaub „to go“ – das Medienecho
Lokale Medien bezeichnen die Aktion treffend als „Feinstaub to go“. Gemeint ist damit, dass nicht mehr nur feste Messstationen, sondern mobile Bürger selbst für Echtzeitdaten sorgen. Dieses flexible Messnetz liefert neue Erkenntnisse: So wurde in einer Feldstudie eine hohe Belastung an stark befahrenen Kreuzungen festgestellt – selbst an Tagen mit scheinbar „guter Luft“ laut offizieller Anzeige.
Eine Studie aus dem Jahr 2019 hatte bereits gezeigt, dass in einem 2,7 km² großen innerstädtischen Bereich durch mobile Sensoren eine deutlich feinere Erfassung der Aerosolverteilung möglich war als mit stationären Messsystemen.
Neue digitale Helfer: Apps zur Feinstaubvermeidung
Ergänzend zur Sensorik gibt es inzwischen eine App, die persönliche Feinstaubbelastung in Echtzeit kalkuliert. Entwickelt vom Forschungszentrum Informatik (FZI) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), kombiniert sie Messwerte, Atemfrequenz und Bewegungsdaten. So wird berechnet, wie viele Feinstaubpartikel eine Person während einer bestimmten Strecke tatsächlich eingeatmet hat.
Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, etwa bei der Wahl gesünderer Routen im Stadtverkehr oder zur Planung emissionsarmer Infrastruktur.
Was Städte aus den Daten lernen können
Die Stadt Karlsruhe plant, die erhobenen Daten langfristig in Planungsprozesse zu integrieren – etwa bei Verkehrsführung, Ampelschaltungen oder der Begrünung von Straßenzügen. Denkbar sind auch temporäre Fahrverbote bei hoher Belastung oder neue Radwege an emissionsarmen Routen.
Potenzielle Maßnahmen auf Basis der Messdaten:
| Maßnahme | Beispiel |
|---|---|
| Umleitung von Hauptverkehrsadern | Alternative Routen für LKW-Verkehr |
| Verkehrsberuhigung | Tempo-30-Zonen in Wohnvierteln |
| Begrünung | Mehr Bäume in Hochbelastungsstraßen |
| ÖPNV-Förderung | Mehr Busspuren & emissionsfreie Flotten |
Citizen Science als Zukunftsmodell?
Das Projekt „CycleSense“ steht exemplarisch für eine neue Welle bürgernaher Wissenschaft. Neben dem Umwelteffekt stärkt es auch das Vertrauen in wissenschaftliche Prozesse und macht komplexe Themen wie Luftreinhaltung greifbar. Die Beteiligung von Jugendlichen zeigt zudem, wie früh Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft gelebt werden kann.
Obwohl die Sensorik nicht den Standard staatlicher Messstationen erfüllt, liefert sie eine entscheidende Ergänzung – gerade im Hinblick auf mikroskalige Problemzonen, die bisher oft unentdeckt blieben.
Wenn Bürger messen, kann Politik handeln
Karlsruhe geht mit „CycleSense“ einen innovativen Weg. Die Kombination aus Bürgerengagement, moderner Sensorik und datengetriebener Stadtplanung hat Vorbildcharakter – nicht nur für andere Städte, sondern auch für eine neue Art von Umweltpolitik. Es zeigt sich: Mit Offenheit, Neugier und etwas Technik können Bürgerinnen und Bürger selbst zur Verbesserung ihrer Lebenswelt beitragen – und machen die Luft ein kleines Stück sauberer.