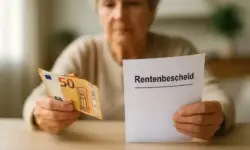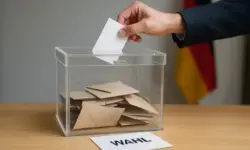Berlin. Der Streit um eine mögliche Urheberpauschale für Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt an Dynamik. Nachdem die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer im Frühjahr ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt haben, wächst der Druck auf die Bundesregierung, klare Regeln zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um Geld – sondern auch um die Frage, wie kreative Leistung im Zeitalter lernender Maschinen geschützt werden kann.
Warum die Länder eine Urheberpauschale fordern
Ein Signal an die Bundesregierung
Die Forderung nach einer „Urheberpauschale für KI“ ist keine spontane Idee. Schon seit Ende 2024 beraten die Länderjustizminister über Wege, wie Urheberinnen und Urheber an der Nutzung ihrer Werke durch KI-Systeme beteiligt werden können. Im März 2025 verabschiedeten die Länderchefs schließlich eine gemeinsame Erklärung: Man fordere „klare gesetzliche Regelungen, die den Schutz geistigen Eigentums auch in der Ära generativer KI sicherstellen“.
Hintergrund ist die zunehmende Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte beim Training großer Sprach- und Bildmodelle. Diese Systeme, darunter bekannte Plattformen wie ChatGPT, Midjourney oder Stable Diffusion, greifen bei der Entwicklung auf riesige Mengen an Texten, Bildern und Musik zurück – oftmals ohne ausdrückliche Zustimmung der Urheber. Die Länder sehen hier ein Ungleichgewicht: KI-Unternehmen profitieren wirtschaftlich, während Kreative leer ausgehen.
Ein neues Vergütungsmodell
Die geplante Urheberpauschale soll dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Dabei könnten KI-Unternehmen ähnlich wie bei den bisherigen Pauschalvergütungen im Urheberrecht – etwa für private Kopien – Abgaben zahlen, die an Verwertungsgesellschaften fließen. Diese würden das Geld anschließend an die Rechteinhaber verteilen. Noch ist unklar, wie hoch eine solche Pauschale ausfallen könnte, doch erste Modelle sprechen von einer anwendungsbezogenen oder volumenabhängigen Berechnung.
Rechtliche Unsicherheiten im Urheberrecht
Wer ist Urheber, wenn KI mitarbeitet?
Ein Kernproblem der Debatte ist die urheberrechtliche Einordnung von KI-generierten Inhalten. Laut dem Bundesministerium der Justiz können nur natürliche Personen Urheber im Sinne des Gesetzes sein. Eine KI, so leistungsfähig sie auch sein mag, gilt juristisch nicht als schöpferische Entität. Das wirft schwierige Fragen auf: Wem gehören die Rechte an einem Text, den ein Mensch mithilfe einer KI erstellt? Und wann ist der Anteil der Maschine so groß, dass die Schöpfungshöhe des Menschen entfällt?
Das Institut für Innovation und Technologie beschreibt diese Situation als „Lücke zwischen technologischer Entwicklung und rechtlicher Anpassung“. Besonders hybride Werke – also solche, die aus menschlicher und maschineller Kreativität entstehen – sind schwer einzuordnen. Das bestehende Urheberrecht stoße hier an seine Grenzen.
Training mit geschützten Inhalten – ein juristisches Minenfeld
Auch beim Training der Modelle herrscht Rechtsunsicherheit. Nach dem deutschen Urheberrecht (§44b UrhG) ist sogenanntes Text- und Data-Mining zwar grundsätzlich erlaubt, doch nur unter bestimmten Bedingungen. Kommerzielle Nutzung, wie sie bei großen KI-Anbietern üblich ist, fällt in vielen Fällen nicht darunter. Eine Studie der Illustratoren-Organisation kam zu dem Schluss, dass beim Training generativer Modelle „regelmäßig eine Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke ohne ausreichende Rechtsgrundlage“ erfolgt.
Damit steht im Raum, dass KI-Unternehmen massenhaft gegen geltendes Urheberrecht verstoßen könnten. Branchenvertreter sprechen von einer „massiven Rechtsverletzung“, die durch klare Lizenz- oder Pauschalmodelle beendet werden müsse.
Ökonomische Modelle für eine gerechte Vergütung
Wie könnte eine Urheberpauschale berechnet werden?
Eine häufige Frage lautet: Wie hoch könnte eine Urheberpauschale für KI-Training in Deutschland sein? Eine verbindliche Zahl gibt es nicht, doch Ökonomen schlagen Beteiligungsmodelle vor, die sich an der Nutzungsintensität orientieren. Eine Studie von Wang et al. (arXiv, 2024) schlägt vor, Urheber proportional zur Häufigkeit ihrer Werke im Trainingsmaterial zu vergüten. Dabei könnten automatisierte Systeme den Anteil jedes Werkes ermitteln und die Pauschale anteilig ausschütten.
Dieses Modell wäre technisch anspruchsvoll, aber gerecht. Es würde sicherstellen, dass besonders häufig genutzte Werke stärker vergütet werden – ähnlich wie Streamingdienste Künstlern je nach Abrufzahlen Tantiemen zahlen.
Ein Blick nach Europa
Eine weitere häufige Frage lautet: Wie würde eine Urheberpauschale im europäischen Kontext aussehen? Die EU arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung des sogenannten AI Acts, der Transparenzpflichten für KI-Anbieter vorsieht. Diese müssen künftig offenlegen, mit welchen Daten ihre Systeme trainiert wurden. Damit könnte ein Fundament geschaffen werden, auf dem nationale Pauschalmodelle aufbauen.
Eine EU-weite Lösung wäre besonders für grenzüberschreitend agierende Unternehmen wichtig, da KI-Modelle selten in nur einem Land entwickelt oder genutzt werden. Die europäischen Verwertungsgesellschaften drängen deshalb auf ein abgestimmtes Verfahren, um „Fragmentierung und Rechtsunsicherheit“ zu vermeiden.
Internationale Ansätze
Auch außerhalb Europas gewinnt das Thema an Bedeutung. In den USA diskutieren Juristen über Sammelklagen gegen KI-Unternehmen, die urheberrechtlich geschützte Werke ohne Lizenz genutzt haben sollen. In Großbritannien prüfen Kulturinstitutionen derzeit, ob bestehende Pauschalvergütungsmodelle auf KI-Trainingsdaten übertragen werden können. Der internationale Druck zeigt: Der Schutz kreativer Leistung ist längst zu einer globalen Frage geworden.
Die Positionen der Kreativwirtschaft
Verlage und Künstler fordern klare Grenzen
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels formulierte es deutlich: „KI-Unternehmen eignen sich Texte, Bilder und Musik an, ohne die Urheber zu beteiligen. Diesen Raubzug gegen die Kreativen wollen wir stoppen.“ Ähnliche Forderungen kommen von Musikerverbänden, Journalistenorganisationen und Filmproduzenten. Alle eint die Sorge, dass die rasante KI-Entwicklung wirtschaftliche Existenzen gefährden könnte.
Die Verwertungsgesellschaften fordern eine Pauschalvergütung, die einfach administrierbar und technologieneutral ausgestaltet ist. Eine zentrale Abgabestelle könnte Zahlungen der KI-Unternehmen entgegennehmen und auf Basis transparenter Kriterien verteilen.
Kritik an der Pauschale
Doch es gibt auch Gegenstimmen. Kritiker befürchten, dass eine solche Abgabe Innovation hemmen und Start-ups benachteiligen könnte. Die praktische Umsetzung – etwa die Erfassung der tatsächlich genutzten Werke – sei aufwendig und technisch schwierig. Zudem ist unklar, wie eine globale Plattform wie OpenAI oder Google rechtlich zur Zahlung einer nationalen Pauschale verpflichtet werden könnte.
Auch aus juristischer Sicht gibt es Einwände. Einige Experten warnen, dass eine Pauschalabgabe die Grenzen des bestehenden Urheberrechts sprengen könnte. Statt neuer Modelle fordern sie eine konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze, kombiniert mit besseren Kontrollmechanismen.
Stimmen aus der Gesellschaft und sozialen Medien
Diskussionen über Transparenz und Verantwortung
In Foren und sozialen Netzwerken zeigt sich, wie emotional das Thema diskutiert wird. Auf Plattformen wie Reddit und Hacker News fordern Nutzerinnen und Nutzer eine Beweislastumkehr: KI-Unternehmen sollen nachweisen müssen, dass sie die Zustimmung für jedes genutzte Werk besitzen. Andere betonen die Notwendigkeit eines funktionierenden „Opt-out“-Systems, das Urhebern erlaubt, ihre Inhalte aus KI-Trainingsdaten herauszunehmen – ein System, das derzeit kaum praktikabel ist.
Auch technologische Aspekte werden debattiert: Viele fordern bessere Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte und mehr Transparenz bei den Trainingsdaten. In den Diskussionen wird deutlich, dass Vertrauen und Nachvollziehbarkeit zentrale Voraussetzungen für eine Akzeptanz von KI-Systemen in der Gesellschaft sind.
Die Rolle der großen Plattformen
Eine weitere Perspektive ergibt sich aus der Diskussion über Selbstverpflichtungen großer Technologiekonzerne. Nachdem einige Unternehmen den freiwilligen EU-KI-Verhaltenskodex nicht unterzeichneten, wächst die Skepsis, ob moralische Appelle genügen. Kritiker sprechen von einer „Governance-Lücke“ zwischen freiwilligen Standards und verbindlichem Recht. Das stärkt die Position der Länder, die auf klare gesetzliche Vorgaben drängen.
Praktische und gesellschaftliche Folgen
Wer profitiert von einer Urheberpauschale?
Von einer Urheberpauschale würden in erster Linie Kreative profitieren – also Autorinnen, Fotografen, Komponisten und andere Kulturschaffende, deren Werke in KI-Trainingssystemen genutzt werden. Aber auch die Gesellschaft insgesamt könnte gewinnen, wenn durch klare Regelungen das Vertrauen in KI-Systeme wächst und rechtliche Konflikte abnehmen.
Wann könnte die Pauschale kommen?
Die Frage, wann eine Urheberpauschale für KI in Deutschland eingeführt wird, bleibt offen. Zwar haben die Länder den Druck erhöht, doch die Bundesregierung hat bislang keine konkreten Gesetzesvorschläge vorgelegt. Experten erwarten, dass frühestens 2026 mit einer Umsetzung gerechnet werden kann – möglicherweise im Rahmen einer größeren Urheberrechtsreform auf EU-Ebene.
Alternative Modelle
Neben der Pauschalvergütung werden auch Lizenzdatenbanken diskutiert, in denen Urheber freiwillig ihre Werke registrieren können. KI-Unternehmen müssten dann Nutzungsrechte erwerben, ähnlich wie beim Musikstreaming. Diese Lösung könnte Pauschalen ergänzen oder langfristig ersetzen. Allerdings sind Aufwand und Kosten solcher Systeme hoch, insbesondere für kleinere Anbieter.
Was eine faire Lösung ausmacht
- Transparente Offenlegung der genutzten Trainingsdaten
- Faire und nachvollziehbare Vergütung für Urheber
- Technisch praktikable Umsetzung ohne Bürokratie
- Internationale Abstimmung, um Schlupflöcher zu vermeiden
Schlussabschnitt: Zwischen Innovation und Gerechtigkeit
Die Debatte um eine Urheberpauschale für KI ist mehr als eine juristische Auseinandersetzung – sie ist ein Kulturkampf um den Wert menschlicher Kreativität im digitalen Zeitalter. Während die Technologie mit rasender Geschwindigkeit Fortschritte macht, bleibt das Recht hinterher. Die Länder haben den ersten Schritt getan, um den Schutz geistiger Arbeit neu zu definieren. Ob daraus tatsächlich eine faire und praktikable Lösung entsteht, hängt davon ab, ob Politik, Wirtschaft und Kreative gemeinsam handeln. Nur dann kann Künstliche Intelligenz ein Werkzeug bleiben – und nicht zur Bedrohung für die schöpferische Vielfalt werden, die unsere Gesellschaft ausmacht.