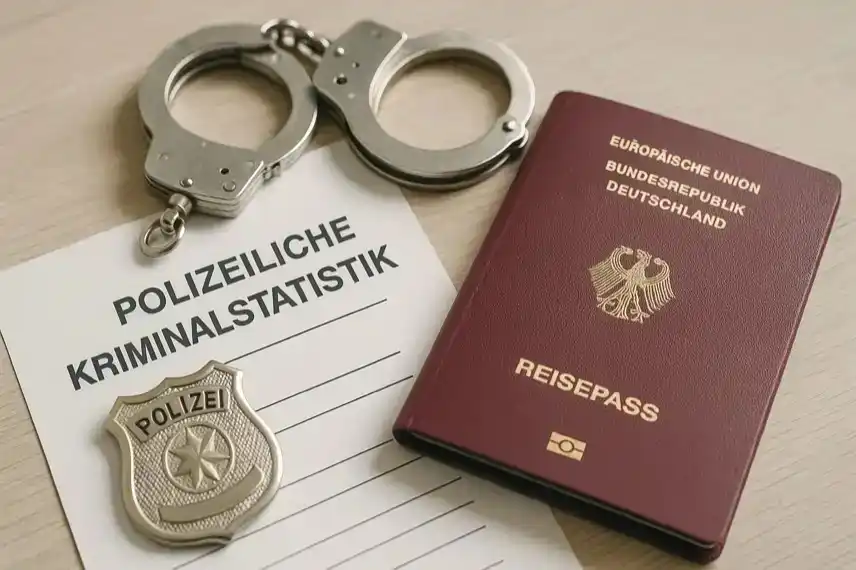
Nordrhein-Westfalen geht bei der Kriminalstatistik einen eigenen Weg: Künftig sollen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) alle Staatsangehörigkeiten von Tatverdächtigen und Opfern erfasst werden. Damit unterscheidet sich das Land von der bundesweiten Praxis, in der bisher nur eine Nationalität berücksichtigt wird. Der Schritt sorgt für Zustimmung, Kritik und eine angeregte Debatte über Sinn, Nutzen und mögliche gesellschaftliche Folgen.
Ein neuer Sonderweg in der Kriminalstatistik
Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat im Sommer 2025 einen Erlass veröffentlicht, nach dem in allen Polizeiberichten künftig auch die Mehrfachstaatsangehörigkeiten von Tatverdächtigen und Opfern ausgewiesen werden. Der Innenminister begründete den Schritt mit den Worten: „Wer die Realität sehen will, muss sie auch messen.“ Damit will das Land eine detailliertere Datengrundlage schaffen, die nach Auffassung der Landesregierung auch bei Haftgründen wie Fluchtgefahr eine Rolle spielen könne.
Bisher sah die bundesweit gültige Vorgabe vor, dass lediglich eine Staatsangehörigkeit erfasst wird – auch wenn eine Person mehrere Pässe besitzt. Nordrhein-Westfalen setzt sich mit diesem Schritt über diese Richtlinie hinweg und schafft ein Modell, das bundesweit Beachtung findet. Besonders bemerkenswert: Die Regelung gilt nicht nur für Tatverdächtige, sondern auch für Opfer.
Politische Reaktionen und Kontroversen
Die Entscheidung stößt auf geteilte Resonanz. Die CDU-geführte Landesregierung betont, dass die neue Statistik lediglich ein Abbild der Realität liefern soll. Die Union auf Bundesebene begrüßt die Initiative und fordert, das Modell bundesweit zu übernehmen. Kritiker aus SPD und Grünen hingegen warnen vor negativen gesellschaftlichen Effekten. Sie befürchten eine Stigmatisierung von Doppelstaatlern und werfen der Landesregierung vor, populistische Argumente zu bedienen.
Ein Grünen-Politiker sprach von „Deutschen zweiter Klasse“, da Doppelstaatler in der Statistik nun separat erscheinen. Die SPD wiederum bezeichnete die Maßnahme als „unsinnig“ und bemängelte, dass die erhobenen Daten keinen zusätzlichen kriminalpolitischen Nutzen hätten. Die Linke reiht sich in diese Kritik ein und warnt vor einer Diskriminierung von Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit.
Die Zahlen im Detail: Doppelstaatsangehörige in NRW
Eine erste Auswertung der Kriminalstatistik 2024 zeigt, dass die Erfassung Mehrfachstaatsangehöriger durchaus Gewicht hat. So hatte rund jeder zehnte Tatverdächtige in NRW eine zweite Staatsangehörigkeit. Besonders auffällig: Jeder sechste Tatverdächtige mit deutschem Pass verfügte zusätzlich über eine weitere Nationalität.
Die am häufigsten erfassten Kombinationen bei deutschen Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024 waren:
| Doppelstaatsangehörigkeit | Anzahl Tatverdächtige (2024) |
|---|---|
| deutsch / türkisch | 10.307 |
| deutsch / polnisch | 6.652 |
| deutsch / russisch | 3.484 |
| deutsch / marokkanisch | 3.125 |
| deutsch / syrisch | 2.185 |
Diese Zahlen verdeutlichen, dass es sich nicht um ein Randphänomen handelt, sondern um einen relevanten Anteil an Tatverdächtigen, die künftig in der Statistik gesondert ausgewiesen werden.
Fragen aus der Gesellschaft
Warum will NRW künftig alle Staatsangehörigkeiten bei Straftaten erfassen?
Die offizielle Begründung lautet, dass nur ein vollständiges Bild über Mehrfachstaatsangehörigkeiten die Realität abbildet. Innenminister Reul erklärte dazu: „Wer die Realität sehen will, muss sie auch messen.“ Kritiker stellen jedoch infrage, ob die detaillierte Erfassung tatsächlich einen praktischen Nutzen bringt.
Gehört die doppelte Staatsangehörigkeit in der Kriminalstatistik zu Diskriminierung?
Während Befürworter Transparenz und genauere Daten fordern, warnen Gegner vor einem diskriminierenden Effekt. Viele befürchten, dass Doppelstaatler als „Deutsche zweiter Klasse“ dargestellt werden. Damit wird deutlich, dass die Debatte nicht nur um Zahlen, sondern auch um gesellschaftliche Symbolik geführt wird.
Polizeiliche und wissenschaftliche Perspektiven
Neben der politischen Debatte melden sich auch Fachleute zu Wort. Aus Reihen der Polizei heißt es, dass eine Statistik allein keine Probleme löse. Die eigentliche Arbeit in der Verbrechensbekämpfung erfolge unabhängig von der Anzahl der Pässe eines Verdächtigen. Zudem wird betont, dass die Erfassung häufig nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt und somit keinen direkten Einfluss auf den polizeilichen Alltag habe.
Wissenschaftliche Stimmen weisen darauf hin, dass die bisherige Kriminalstatistik oft blinde Flecken aufwies. Doppelstaatler wurden bislang meist als Deutsche geführt, was das Bild über sogenannte „Ausländerkriminalität“ verzerrte. Einige Experten plädieren daher für eine umfassendere Reform der PKS, um die Kategorien klarer zu trennen.
Die Debatte im Netz: Wahrnehmung und Polarisierung
In sozialen Medien und Foren wird die Thematik leidenschaftlich diskutiert. Auf Reddit etwa entbrannte eine Debatte über den Anteil von Migranten an Straftaten in Deutschland. Während einige Nutzer betonen, dass über 40 Prozent der Straftäter einen Migrationshintergrund hätten, weisen andere darauf hin, dass nach wie vor die Mehrheit der Straftaten von Deutschen begangen werde.
Auch auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) verbreiten Nutzer Zahlen zu den häufigsten Doppelstaatsangehörigkeiten unter Tatverdächtigen. Solche Diskussionen verdeutlichen, wie stark die Wahrnehmung von Kriminalität von subjektiven Interpretationen und persönlichen Überzeugungen geprägt ist.
Wie viele Tatverdächtige in NRW haben eine zweite Staatsangehörigkeit?
Die Zahlen aus dem Jahr 2024 machen deutlich: Rund 10 Prozent aller Tatverdächtigen und 17 Prozent der deutschen Tatverdächtigen hatten eine zweite Staatsangehörigkeit. Diese Daten sollen nun transparenter dargestellt werden, um die tatsächlichen Verhältnisse besser nachvollziehbar zu machen.
Welche Staatsangehörigkeits-Kombinationen sind in NRW bei Straftaten am häufigsten?
Wie die Tabelle oben zeigt, sind deutsch-türkische, deutsch-polnische und deutsch-russische Doppelstaatsangehörigkeiten am häufigsten vertreten. Damit bildet sich auch die Migrationsgeschichte des Landes in den Kriminalstatistiken ab.
Bundesweite Perspektive und Forderungen
Derzeit gilt das neue Erfassungsmodell nur in Nordrhein-Westfalen. Auf Bundesebene wird jedoch bereits diskutiert, ob das Modell übernommen werden sollte. Die Union fordert dies ausdrücklich, während SPD und Grüne entschieden dagegenhalten. Damit wird NRW zu einem Testfeld, dessen Ergebnisse bundesweite Auswirkungen haben könnten.
Gilt das neue Erfassungsmodell nur in NRW oder bundesweit?
Offiziell bleibt es ein Alleingang von NRW. Bundesweit gilt weiterhin, dass nur eine Staatsangehörigkeit in der PKS aufgenommen wird. Ob es zu einer Ausweitung kommt, hängt von den politischen Mehrheiten auf Bundesebene ab.
Gibt es polizeiliche Kritik an der Erfassung aller Staatsangehörigkeiten?
Tatsächlich gibt es auch innerhalb der Sicherheitsbehörden Zweifel. Einige Stimmen betonen, dass die statistische Erfassung für die tägliche Polizeiarbeit wenig Relevanz habe. Sie könne zwar neue Vergleichsdaten liefern, trage aber nicht unmittelbar zur Aufklärung oder Verhinderung von Straftaten bei.
Einordnung und Ausblick
Die Entscheidung Nordrhein-Westfalens, künftig alle Staatsangehörigkeiten bei Straftaten zu erfassen, hat eine breite Diskussion ausgelöst. Sie berührt Fragen der Statistik, der politischen Symbolik und der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Die Zahlen zeigen, dass es sich nicht um ein Randthema handelt: Jeder sechste deutsche Tatverdächtige in NRW ist Doppelstaatler. Doch ob diese Detailtiefe zu einem besseren Verständnis von Kriminalität führt oder lediglich neue Konfliktlinien aufreißt, bleibt umstritten.
Im öffentlichen Diskurs zeigt sich eine deutliche Polarisierung. Während Befürworter Transparenz und Realitätssinn einfordern, warnen Gegner vor Populismus und Diskriminierung. Auch innerhalb der Polizei gibt es unterschiedliche Einschätzungen zum Nutzen der Maßnahme. In den sozialen Medien wiederum spiegelt sich die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Debatte wider: von nüchternen Statistikauswertungen bis zu emotional geführten Auseinandersetzungen über Migration und Kriminalität.
Klar ist: Nordrhein-Westfalen hat mit seinem Sonderweg ein Signal gesetzt, das weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus Wirkung entfaltet. Ob es künftig weitere Länder oder gar den Bund geben wird, die diesem Modell folgen, ist offen. Sicher ist jedoch, dass die Diskussion über Staatsangehörigkeiten in der Kriminalstatistik nicht so schnell abebben wird – im Gegenteil: Sie dürfte die Debatte über Kriminalität, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt in den kommenden Jahren weiter intensivieren.

































