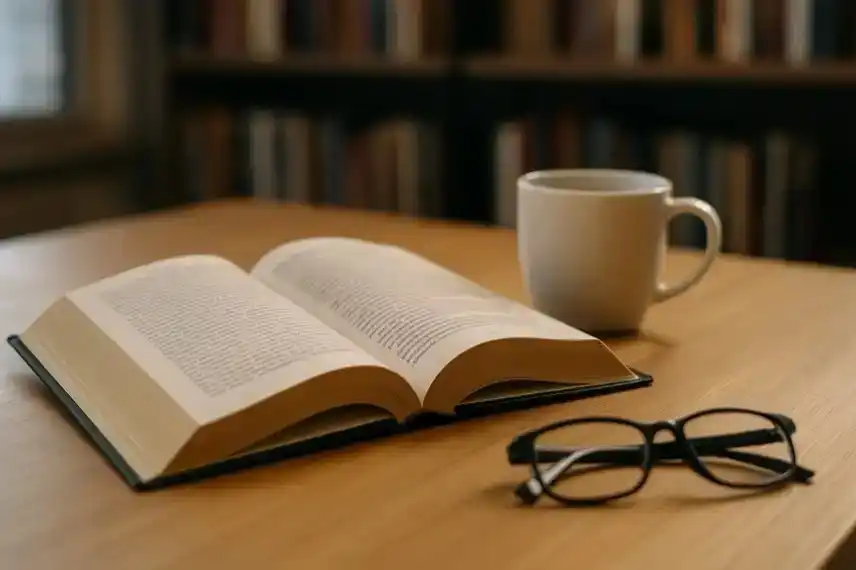Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung den kirchlichen Arbeitgebern in Deutschland neue Spielräume eingeräumt. Das Urteil bekräftigt das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und erlaubt es kirchlichen Einrichtungen unter bestimmten Bedingungen, die Religionszugehörigkeit als Einstellungskriterium zu verlangen. Für Befürworter ist das ein Sieg der Religionsfreiheit – Kritiker sehen die Gleichbehandlung im Arbeitsleben in Gefahr.
Ein Urteil mit weitreichender Signalwirkung
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat mit seinem Beschluss vom 29. September 2025 ein richtungsweisendes Urteil gefällt, das die Grenzen zwischen staatlichem Arbeitsrecht und kirchlicher Selbstbestimmung neu zieht. Im Mittelpunkt steht das Grundrecht auf Religionsfreiheit, das nach Auffassung des Gerichts auch die Freiheit einschließt, das eigene religiöse Ethos in den Arbeitsbeziehungen umzusetzen. Damit wurde ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aufgehoben, das eine Diakonie-Einrichtung zuvor zur Wiedergutmachung gegenüber einer konfessionslosen Bewerberin verpflichtet hatte.
Das BVerfG stellte klar: Staatliche Gerichte dürfen „keine theologische Bewertung“ des religiösen Ethos vornehmen. Die Entscheidung stärkt das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, das in Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes verankert ist und durch Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung ergänzt wird. Damit dürfen Kirchen und ihre Wohlfahrtsorganisationen künftig stärker selbst entscheiden, welche religiösen Anforderungen sie an Bewerberinnen und Bewerber stellen.
Der konkrete Fall: Eine abgelehnte Sozialpädagogin
Der Fall, der zur Entscheidung führte, begann bereits 2012. Eine konfessionslose Sozialpädagogin aus Berlin hatte sich auf eine Stelle bei der Diakonie beworben. In der Ausschreibung wurde die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche als Voraussetzung genannt. Da die Bewerberin keiner Kirche angehörte, wurde sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen – und klagte wegen Diskriminierung aufgrund ihrer Religion beziehungsweise Konfessionslosigkeit.
Das Bundesarbeitsgericht hatte der Klägerin 2018 recht gegeben und entschieden, dass kirchliche Arbeitgeber eine Religionszugehörigkeit nur verlangen dürfen, wenn dies „objektiv geboten“ sei. Das Bundesverfassungsgericht hingegen stellte nun klar, dass die Diakonie plausibel dargelegt habe, warum ein christliches Profil für die ausgeschriebene Position relevant sei. Damit wurde das BAG-Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen.
Selbstbestimmung statt staatlicher Kontrolle
Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe betonten, dass es nicht Aufgabe staatlicher Gerichte sei, kirchliche Glaubensinhalte zu bewerten. Sie wiesen ausdrücklich darauf hin, dass staatliche Stellen nicht entscheiden dürfen, was „wesentlich“ für das religiöse Ethos einer Kirche ist. Damit wird das Verhältnis zwischen Kirche und Staat erneut stärker im Sinne der kirchlichen Autonomie ausgelegt.
Diese Sichtweise stößt auf geteiltes Echo. Vertreter der Kirchen begrüßen das Urteil als Bestätigung ihres besonderen Status. „Das Gericht hat die Glaubensfreiheit konsequent umgesetzt und klargestellt, dass kirchliche Arbeitgeber ihre religiöse Identität wahren dürfen“, hieß es aus kirchlichen Kreisen. Arbeitsrechtler wie Ernesto Klengel hingegen kritisieren, das Gericht habe den von der Europäischen Rechtsprechung gesetzten Rahmen „weit interpretiert“ und öffne damit Tür und Tor für mögliche Ungleichbehandlungen.
Das Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und Gleichbehandlung
Die Entscheidung des BVerfG markiert einen erneuten Wendepunkt in der jahrelangen Debatte über das kirchliche Arbeitsrecht. In Deutschland beschäftigen kirchliche Arbeitgeber – darunter Diakonie, Caritas und weitere Einrichtungen – rund 1,8 Millionen Menschen. Diese arbeiten häufig in Bereichen wie Pflege, Bildung oder Sozialarbeit, die nicht unmittelbar religiös geprägt sind. Genau hier verläuft die juristische Bruchlinie: Wo endet die religiöse Verkündigung, und wo beginnt das säkulare Arbeitsverhältnis?
Die Antwort des Gerichts lautet: Je größer die Bedeutung der betroffenen Position für die religiöse Identität der Religionsgemeinschaft ist, desto stärker wiegt das kirchliche Selbstbestimmungsrecht. Für Tätigkeiten, die unmittelbar mit dem religiösen Auftrag verbunden sind – etwa in Seelsorge, Religionspädagogik oder Leitungspositionen –, darf die Kirchenmitgliedschaft daher als Voraussetzung gelten. In eher administrativen oder sozialen Aufgabenbereichen müsse jedoch eine sorgfältige Abwägung erfolgen.
Wann ist eine Religionszugehörigkeit unzulässig?
Eine häufig gestellte Frage lautet: Wann dürfen kirchliche Arbeitgeber die Kirchenmitgliedschaft nicht verlangen? Nach der bisherigen Rechtsprechung ist dies dann unzulässig, wenn der religiöse Bezug der Stelle nur vorgeschoben oder allgemein gehalten ist. Tätigkeiten, die keinen direkten Einfluss auf das religiöse Leben der Gemeinschaft haben, dürfen in der Regel auch von konfessionslosen Bewerberinnen und Bewerbern ausgeübt werden. Diese Abwägung bleibt nach dem Karlsruher Urteil jedoch künftig stärker Sache der Kirchen selbst.
Reaktionen aus Politik und Gesellschaft
In Politik und Öffentlichkeit löste das Urteil gemischte Reaktionen aus. Während kirchliche Vertreter das Urteil als „Sicherung religiöser Identität“ bezeichneten, warnten Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen vor einer „Rückkehr zu alten Privilegien“. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di etwa fordert seit Jahren, kirchlich Beschäftigte vollständig in das staatliche Arbeitsrecht einzubeziehen.
Auch in sozialen Medien wie Reddit und auf Arbeitnehmerforen diskutieren viele Betroffene offen über die Auswirkungen. Mehrere Nutzer berichten, dass ein Kirchenaustritt den Arbeitsplatz gefährden könne oder dass sie sich aufgrund fehlender Kirchenzugehörigkeit nicht trauten, sich auf bestimmte Stellen zu bewerben. Eine Petition auf dem ver.di-Forum mit dem Titel „Gleiches Recht für kirchlich Beschäftigte“ fordert inzwischen eine klare gesetzliche Regelung zur Trennung von Glaubensbekenntnis und Arbeitsrecht.
Rechtliche Grundlagen des kirchlichen Arbeitsrechts
Das kirchliche Arbeitsrecht basiert auf einem besonderen rechtlichen Fundament: Artikel 140 des Grundgesetzes erklärt Teile der Weimarer Reichsverfassung für weiterhin gültig. Artikel 137 WRV garantiert Kirchen das Recht, ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten. Daraus ergibt sich ein Sonderstatus, der auch die Gestaltung von Dienstverhältnissen einschließt. Ergänzt wird dies durch Artikel 4 GG, der die Religionsfreiheit schützt.
In der Praxis bedeutet das: Kirchen können eigene Loyalitätsanforderungen formulieren, etwa in Bezug auf Lebensführung, Eheschließung oder Konfession. Diese Regeln sind in kirchlichen Grundordnungen niedergelegt und variieren zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Zwar gilt auch hier das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), doch mit gewissen Ausnahmen zugunsten der kirchlichen Selbstbestimmung.
Welche Folgen hat das Urteil für Bewerberinnen und Bewerber?
Nach dem Karlsruher Beschluss dürfen kirchliche Arbeitgeber künftig unter bestimmten Umständen Bewerberinnen und Bewerber ohne Kirchenmitgliedschaft ablehnen – sofern sie überzeugend darlegen können, warum die Religionszugehörigkeit für die Position wesentlich ist. Staatliche Gerichte müssen dabei prüfen, ob diese Begründung plausibel und verhältnismäßig ist, dürfen aber nicht selbst über theologische Fragen urteilen.
Für Bewerberinnen und Bewerber bedeutet dies mehr Unsicherheit. Konfessionslose oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen müssen künftig genauer darauf achten, welche Anforderungen in kirchlichen Stellenausschreibungen gestellt werden. Gleichzeitig betont das BVerfG, dass der Schutz vor Diskriminierung nach wie vor gilt – aber innerhalb der Grenzen der kirchlichen Selbstbestimmung interpretiert werden muss.
Der europäische Kontext: Konflikt mit dem EuGH?
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht auch im Spannungsverhältnis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser hatte 2018 im selben Fall entschieden, dass die Religionszugehörigkeit nur dann als Einstellungsvoraussetzung gelten dürfe, wenn sie objektiv notwendig sei. Karlsruhe interpretiert diese Grenze nun weiter und betont das nationale Verständnis von Religionsfreiheit.
Rechtsexperten sehen darin ein mögliches Konfliktpotenzial zwischen nationalem Verfassungsrecht und europäischem Diskriminierungsrecht. Sollte der Fall erneut vor den EuGH gelangen, könnte es zu einer erneuten Abwägung zwischen kirchlicher Autonomie und Arbeitnehmerrechten kommen. Damit bleibt die Frage, ob Deutschland langfristig an seinem Sonderweg im kirchlichen Arbeitsrecht festhalten kann, weiterhin offen.
Praktische Auswirkungen für kirchliche Arbeitgeber
Kirchliche Einrichtungen werden künftig ihre Stellenausschreibungen und internen Verfahren sorgfältiger dokumentieren müssen. Das Gericht erwartet, dass nachvollziehbar dargelegt wird, weshalb eine Kirchenmitgliedschaft für eine bestimmte Position erforderlich ist. Die Entscheidung kann also zu mehr interner Bürokratie führen, gleichzeitig aber auch Rechtssicherheit schaffen. Einrichtungen wie Diakonie und Caritas betonen, dass sie ihre religiöse Identität nur durch eine solche Differenzierung wahren können.
Die Sicht der Arbeitnehmervertretungen
Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften zeigen sich enttäuscht. Sie kritisieren, dass das Urteil ein „Rückschritt für die Gleichstellung“ sei. Nach Ansicht des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeitsrecht sind kirchliche Sonderregelungen nur in engen Grenzen verfassungsgemäß und sollten langfristig abgebaut werden. Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert, das Verhältnis zwischen kirchlichem Selbstbestimmungsrecht und individuellen Arbeitsrechten neu auszutarieren – insbesondere mit Blick auf Bewerbungen von Konfessionslosen.
Wie sich das Urteil auf die Arbeitswelt auswirkt
Deutschland steht mit dieser Regelung europaweit weitgehend allein da. In den meisten EU-Mitgliedsstaaten sind religiöse Loyalitätsanforderungen nur in Ausnahmefällen zulässig. Dennoch betont das BVerfG, dass die deutsche Verfassung einen besonders hohen Rang der Religionsfreiheit vorsieht. Das Urteil könnte langfristig die juristische Praxis verändern – nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern auch in anderen Organisationen mit weltanschaulichem Hintergrund.
Karlsruhes Entscheidung im gesellschaftlichen Kontext
In einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, wirft die Entscheidung auch gesellschaftliche Fragen auf. Welche Rolle sollen religiöse Werte im öffentlichen Leben spielen? Und wie viel Einfluss dürfen religiöse Institutionen auf das Arbeitsrecht nehmen? Laut aktuellen Umfragen sehen rund 60 Prozent der Deutschen kirchliche Sonderrechte kritisch, insbesondere, wenn sie zu Benachteiligungen führen könnten. Gleichzeitig befürworten viele die Idee, dass religiöse Organisationen ihre Identität eigenständig schützen dürfen.
Abschließende Betrachtung: Zwischen Glaubensfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung
Das Karlsruher Urteil markiert keinen endgültigen Schlusspunkt, sondern einen neuen Abschnitt in der Auseinandersetzung zwischen Glaubensfreiheit und Gleichbehandlung. Es stärkt die Kirchen in ihrem Selbstverständnis, zwingt sie aber zugleich, ihre Entscheidungen transparenter zu begründen. Für Bewerberinnen und Bewerber bleibt das Spannungsfeld bestehen: Wer für kirchliche Arbeitgeber arbeiten will, muss künftig stärker auf religiöse Anforderungen achten. Für die Gesellschaft stellt sich die Frage, wie weit die Sonderrechte religiöser Organisationen reichen dürfen – und ob sie in einer zunehmend säkularen Arbeitswelt noch zeitgemäß sind.