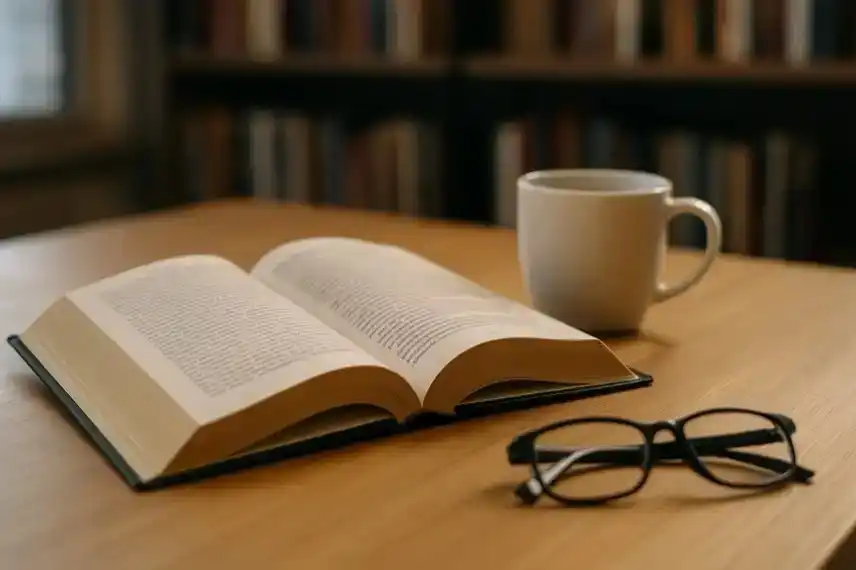Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am 21. August 2025 über die Verfassungsbeschwerde des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gegen den novellierten Staatsvertrag. Die Auseinandersetzung betrifft zentrale Fragen der Rundfunkfreiheit, der Programmautonomie und der Staatsferne. Das Urteil wird Signalwirkung für die gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunklandschaft in Deutschland haben.
Hintergrund: Ein Sender in der Krise
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg steht seit der sogenannten Schlesinger-Affäre im Jahr 2022 unter besonderer Beobachtung. Damals hatten Vorwürfe zu Vetternwirtschaft, überhöhten Ausgaben und mangelnder Transparenz den öffentlich-rechtlichen Sender erschüttert. In der Folge wurde die Führungsstruktur des rbb umgebaut, eine neue Intendanz eingesetzt und eine umfassende Debatte über Kontrolle und Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angestoßen.
Die Länder Berlin und Brandenburg verabschiedeten daraufhin Ende 2023 einen neuen rbb-Staatsvertrag, der die Strukturen der Anstalt tiefgreifend verändern sollte. Bereits kurz nach Inkrafttreten kündigte der rbb jedoch an, dagegen in Karlsruhe vorzugehen. Die Begründung: Die Neuregelungen verletzten die Rundfunkfreiheit und griffen zu stark in die organisatorische und programmliche Autonomie der Anstalt ein.
Die zentralen Streitpunkte im Überblick
Die Verfassungsbeschwerde des rbb richtet sich gegen eine Reihe konkreter Vorgaben im neuen Staatsvertrag:
- Auseinanderschaltung im Fernsehen: Täglich muss das rbb-Programm für 60 Minuten in ein Berliner und ein Brandenburger Programm getrennt werden. Diese Pflicht empfindet die Anstalt als unzulässige Programmsteuerung.
- Regionale Infrastruktur: Der Vertrag schreibt die Einrichtung von Regionalstudios in Cottbus/Chóśebuz und Frankfurt (Oder) sowie Regionalbüros in Brandenburg an der Havel, Prenzlau und Perleberg zwingend vor.
- Leitung der Landesangebote: Neue Führungspositionen für die regionalen Angebote sollen vom Rundfunkrat gewählt werden – nach Ansicht des rbb ein Eingriff in die interne Organisation.
- Direktorium: Ein zusätzliches Leitungsorgan schwäche die Kompetenzen der Intendanz und könne Entscheidungen verkomplizieren.
- Ausschreibungspflichten: Alle Stellen müssen öffentlich ausgeschrieben werden, was aus Sicht des rbb die Personalautonomie einschränkt.
- Haftungs- und Compliance-Regeln: Intendanz und Gremienmitglieder sollen für Pflichtverletzungen haftbar gemacht werden – ein Detail, das über bisherige Regelungen hinausgeht.
- Gehaltsdeckel: Das Grundgehalt der Intendantin darf nicht höher sein als die Besoldungsgruppe B11 im Beamtenrecht.
Die Positionen von Sender und Ländern
Der rbb argumentiert, dass diese Regelungen über das hinausgehen, was Länder den Anstalten vorschreiben dürfen. „Wir sehen die Rundfunkfreiheit verletzt, weil der Staatsvertrag Detailregelungen enthält, die eigentlich allein in die Entscheidungskompetenz der Anstalt fallen“, heißt es in Stellungnahmen aus der Senderführung. Die Anstalt sieht sich durch den Staatsvertrag in eine Rolle gedrängt, die keine eigenständige Programmgestaltung mehr erlaubt.
Die Länder Berlin und Brandenburg hingegen verteidigen die Novelle als notwendigen Schritt. Nach den Krisen der vergangenen Jahre sei es unerlässlich, Transparenz und Kontrolle zu stärken. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte mehrfach, dass die Vorgaben im Vertrag angemessen seien, um das Vertrauen in den rbb wiederherzustellen. Aus Sicht der Politik diene der Vertrag nicht der Gängelung, sondern der Stabilisierung.
Historische Leitplanken aus Karlsruhe
Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe werden den Staatsvertrag am Maßstab früherer Entscheidungen messen. Besonders relevant ist das sogenannte ZDF-Urteil aus dem Jahr 2014, das die Staatsferne der Rundfunkanstalten bekräftigte und die Drittelgrenze für staatliche oder staatsnahe Vertreter in Aufsichtsgremien festlegte. Ebenso wichtig ist der Beschluss zum Rundfunkbeitrag aus dem Jahr 2021, in dem das Gericht die funktionsgerechte Finanzierung der Anstalten als essenziell bestätigte.
Beide Entscheidungen setzen Grenzen, aber auch Gestaltungsspielräume für den Gesetzgeber. Genau diese Abwägung – wo endet der politische Spielraum, wo beginnt ein unzulässiger Eingriff in die Programmautonomie – steht nun im Mittelpunkt des rbb-Verfahrens.
Weitere Aspekte des Staatsvertrags
Über die bekannten Streitpunkte hinaus enthält der Vertrag eine Reihe von Regelungen, die in der Öffentlichkeit bisher weniger Beachtung gefunden haben:
- Ostdeutsche Biografien: Bei der Besetzung von Führungspositionen sollen Bewerberinnen und Bewerber mit biografischem Bezug zu Berlin und Brandenburg, speziell Personen mit ostdeutscher Biografie, berücksichtigt werden.
- Minderheiten und Nachbarschaft: Der Vertrag verpflichtet den rbb, sorbische/wendische Kultur, Niederdeutsch, die Belange von Sinti und Roma sowie die Verständigung mit dem Nachbarland Polen besonders zu berücksichtigen.
- Künstliche Intelligenz: Der Einsatz von virtuellen Elementen und KI in journalistischen Angeboten ist ausdrücklich erlaubt, muss aber den Grundsätzen seriöser Berichterstattung folgen.
- Digitale Transformation: Der Vertrag ermöglicht, lineare Hörfunkangebote ins Netz zu überführen, jedoch nur nach einem geregelten Verfahren mit öffentlicher Beteiligung und gutachterlicher Untersuchung.
- Technische Infrastruktur: Um die Digitalisierung voranzutreiben, darf die analoge terrestrische Versorgung schrittweise eingestellt werden.
- Datenschutz: Die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist künftig in der Gremiengeschäftsstelle verankert und muss jährlich öffentlich berichten.
Fragen aus der Öffentlichkeit
Warum klagt der rbb gegen den Staatsvertrag?
Viele Menschen fragen, warum der Sender überhaupt den Weg nach Karlsruhe eingeschlagen hat. Der Kern der Klage liegt darin, dass der rbb die zahlreichen Detailregelungen als unzulässige Eingriffe in seine Autonomie versteht. Vor allem die Pflicht zur täglichen Auseinanderschaltung, die Standortvorgaben und die Einführung des Direktoriums gelten als Beeinträchtigungen der verfassungsrechtlich garantierten Rundfunkfreiheit.
Was genau regelt der neue rbb-Staatsvertrag?
Der Vertrag ist eine Art „Grundgesetz“ des rbb. Er legt die Struktur, Finanzierung, Aufsicht und Programmschwerpunkte der Anstalt fest. Dazu gehören regionale Mindestangebote, Transparenzpflichten, Gehaltsobergrenzen und Regelungen zur Digitalisierung. Während Politik und Gremien die Vorgaben als notwendige Reform verstehen, empfindet der rbb viele Punkte als Übersteuerung.
Mit welchen Argumenten verteidigen Berlin und Brandenburg den Staatsvertrag?
Die Länder verweisen darauf, dass der Sender nach den Skandalen der vergangenen Jahre Vertrauen zurückgewinnen müsse. Strenge Regeln für Ausschreibungen, Gehaltsgrenzen und Kontrollinstanzen seien der einzige Weg, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. „Der Staatsvertrag ist unsere Antwort auf die Krise des rbb“, so wird aus den Landtagen betont. Kritiker entgegnen, dass es keine staatliche Detailsteuerung geben dürfe, auch nicht nach einer Krise.
Wer vertritt den rbb vor dem Bundesverfassungsgericht?
Der rbb hat mit Professor Joachim Wieland einen renommierten Staatsrechtler als Prozessvertreter engagiert. Wieland ist bekannt für seine Expertise im Verfassungs- und Medienrecht und vertritt den Sender gegenüber den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe. Mit seiner Unterstützung erhofft sich die Anstalt, die verfassungsrechtlichen Grenzen der Länderkompetenz klarziehen zu lassen.
Wann fällt die Entscheidung in Karlsruhe?
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verkündung für den 21. August 2025 um 9:30 Uhr angesetzt. Damit wird das Urteil noch im Sommer bekannt gegeben und könnte schon bald direkte Auswirkungen auf die Arbeit des rbb haben. Unabhängig vom Ausgang wird die Entscheidung als richtungsweisend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten.
Die gesellschaftliche Debatte
Die Klage wird nicht nur juristisch, sondern auch gesellschaftlich diskutiert. Gewerkschaften wie ver.di kritisieren, dass einige Vorgaben zu sehr in die Rundfunkfreiheit eingreifen. Gleichzeitig begrüßen sie die erweiterte Mitbestimmung der Beschäftigten. In der Netzpolitik-Szene wird bemängelt, dass der Vertrag die digitale Zukunft nicht ausreichend abbildet. In Foren und sozialen Medien wiederum dominieren oft Beiträge, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich infrage stellen und den Fall in die allgemeine Debatte über den Rundfunkbeitrag einordnen.
Auswirkungen auf Personal und Struktur
Der rbb beschäftigt aktuell über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis 2025 ist ein Abbau von etwa 250 Stellen geplant. Die zusätzlichen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag – wie regionale Auseinanderschaltungen und neue Studios – könnten die Personalstruktur beeinflussen. Befürchtet wird, dass organisatorische Pflichten zu Lasten der Programmvielfalt gehen.
Der technische Blick: DAB+, UKW und Streaming
Auch die technischen Aspekte des Staatsvertrags sind umstritten. Der Vertrag erlaubt die schrittweise Einstellung der analogen Verbreitung, was Befürchtungen über eine mögliche UKW-Abschaltung auslöst. Gleichzeitig soll der Sender digitaler werden, durch DAB+ und Internetangebote. In sozialen Medien wurde mehrfach kritisiert, dass DAB+ im Vertrag zu kurz komme und die Weichenstellung nicht konsequent genug sei.
Einordnung und Ausblick
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird weit über den rbb hinaus wirken. Sie beantwortet die Frage, wie stark die Länder in die Organisation einer Rundfunkanstalt eingreifen dürfen. Werden die Vorgaben als verfassungswidrig gewertet, müssten Berlin und Brandenburg zentrale Teile des Staatsvertrags überarbeiten. Sollte Karlsruhe die Regelungen dagegen bestätigen, könnte dies den Handlungsspielraum der Länder bei künftigen Reformen erheblich erweitern.
Unabhängig vom Ausgang steht fest: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich in einer Phase der Transformation. Zwischen Digitalisierung, Vertrauensverlust und Sparzwängen muss er seine Rolle neu definieren. Das Karlsruher Urteil wird dafür ein entscheidender Wegweiser sein – für den rbb, aber auch für ARD, ZDF und Deutschlandradio.