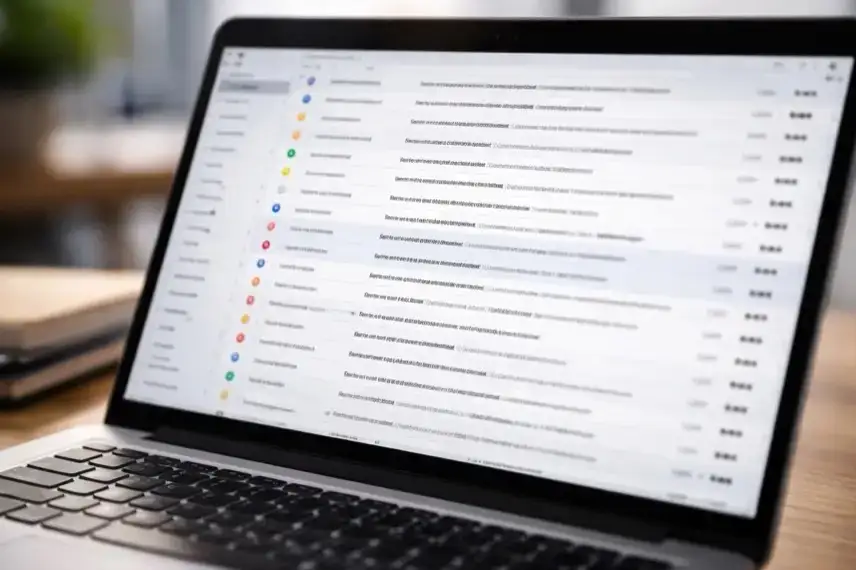Berlin – Die Debatte um die Zukunft der Energieversorgung bekommt neue Dynamik: Während weltweit an innovativen Reaktoren gearbeitet wird, beschäftigt sich auch Deutschland wieder intensiver mit der Kernenergie. Doch kommt es wirklich zu einem Comeback der Atomkraft – oder bleibt es bei politischen Absichtserklärungen?
Globale Renaissance: Ein Comeback mit Anlauf
Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für das Jahr 2025 einen globalen Höchststand in der Stromerzeugung durch Kernenergie. Mehr als 70 Gigawatt neuer Kapazitäten sind weltweit im Bau – ein Niveau, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. In mehr als 40 Staaten, darunter Frankreich, China, Großbritannien, Indien und Tschechien, werden derzeit neue Reaktoren geplant, gebaut oder in Betrieb genommen. Selbst in Ländern wie Belgien oder Dänemark, die lange Zeit atomkritisch waren, zeichnet sich ein Meinungsumschwung ab.
Wichtige Treiber dieser Entwicklung sind nicht nur geopolitische Unsicherheiten und die Suche nach einer energiepolitischen Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, sondern auch der steigende Energiehunger durch digitale Infrastruktur. Besonders der Ausbau von Rechenzentren, KI-Serverfarmen und Datenclustern verlangt nach einer stabilen, emissionsarmen Grundlastenergie – eine Lücke, die die Atomkraft aus Sicht vieler Investoren zu schließen vermag.
Technologische Neuerfindung: Small Modular Reactors im Fokus
Ein Begriff dominiert die Diskussion um die neue Atomkraft: Small Modular Reactors, kurz SMRs. Diese kompakten Reaktoren sollen mit Leistungen zwischen 50 und 300 Megawatt nicht nur wirtschaftlicher und sicherer sein als ihre Vorgänger, sondern auch industriell vorgefertigt werden können. Weltweit sind derzeit über 80 verschiedene SMR-Designs in der Entwicklung, etwa in Kanada, Großbritannien, Polen, Tschechien und den USA.
Ein Reddit-Nutzer auf r/nuclear fasste die Diskussion treffend zusammen: „The debate centers around whether small modular reactors or extending the lifespan of existing plants is the most effective path forward.“ Die Hoffnung auf Skaleneffekte und einfachere Genehmigungsverfahren sorgt für Investitionen in Milliardenhöhe. Unternehmen wie Rolls-Royce, GE Hitachi oder newcleo entwickeln eigene Konzepte, die schon vor Ende der Dekade kommerziell einsetzbar sein könnten.
Was sind Small Modular Reactors (SMRs) und warum gelten sie als Hoffnungsträger?
SMRs sind kleine, standardisierte Kernkraftwerke, die meist unterirdisch gebaut werden und mit passiven Sicherheitssystemen ausgestattet sind. Sie gelten als flexibler, schneller zu errichten und kostengünstiger als konventionelle Großreaktoren. Kritik bleibt jedoch: Noch sind keine SMRs in westlichen Ländern im regulären Betrieb. Zudem bestehen weiterhin Herausforderungen in Bezug auf Entsorgung, Kostenkalkulation und regulatorische Prozesse.
Die deutsche Perspektive: Wandel ohne Wende?
In Deutschland ist das letzte Atomkraftwerk im März 2023 vom Netz gegangen. Trotzdem wird das Thema auch hierzulande wieder verstärkt diskutiert – vor allem durch die politische Rhetorik der neuen Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz. Zwar betonen CDU und CSU, dass man offen für neue Technologien sei und mit europäischen Partnern kooperieren wolle, doch von einer konkreten Rückkehr zu betriebsfähigen Reaktoren ist nicht die Rede.
„Die bestehenden Anlagen bleiben vom Netz. Eine Wiederinbetriebnahme ist ausgeschlossen“, heißt es offiziell aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Auch Energieversorger wie RWE und E.ON zeigen sich skeptisch: Zu lange Genehmigungsprozesse, zu hohe Kosten, zu wenig gesellschaftlicher Rückhalt. RWE-Chef Markus Krebber formulierte es kürzlich deutlich: „Wir sehen keine wirtschaftliche Basis für ein deutsches Atomkraft-Comeback.“
Wird Deutschland 2025 die Atomkraft wieder einführen?
Realistisch betrachtet: nein. Die politische Diskussion bewegt sich derzeit eher in Richtung Forschung und Kooperation bei SMRs oder Fusionstechnologien. Ein tatsächlicher Wiedereinstieg mit betriebsfähigen Anlagen vor 2030 ist angesichts fehlender Infrastruktur und breiter Ablehnung wenig wahrscheinlich.
Öffentliche Meinung: Zwischen Skepsis und Pragmatismus
Dennoch verändert sich die gesellschaftliche Stimmung zur Atomkraft. In Deutschland sprechen sich laut aktuellen Umfragen bis zu 55 % der Befragten für eine Wiederbelebung der Kernenergie aus. In den USA liegt die Zustimmung sogar bei über 70 %. Besonders deutlich: Menschen mit höherem Informationsstand neigen überdurchschnittlich stark zur Befürwortung.
In welcher Rolle spielt öffentliche Meinung beim Atomkraft‑Comeback?
Sie ist zentral. Energiepolitik ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch des gesellschaftlichen Vertrauens. Studien zeigen: Transparenz, Beteiligung und nachvollziehbare Sicherheitskonzepte erhöhen die Akzeptanz deutlich. Ohne diese „soziale Lizenz“ werden viele Projekte politisch nicht durchsetzbar sein.
Wirtschaft und Investitionen: Atomkraft für die digitale Welt?
Große Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon, Meta oder Google investieren massiv in neue Atomkraftlösungen. Hintergrund ist der explosionsartig wachsende Energiebedarf durch künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und Rechenzentren. Google hat bereits Vereinbarungen mit mehreren SMR-Entwicklern getroffen und investiert in Projekte mit 600 MW Leistung – rein zur Deckung eigener Infrastruktur.
Warum investieren Google und andere Tech‑Konzerne in Atomkraft?
Der Grund ist simpel: Planungssicherheit. Solar und Wind unterliegen Schwankungen. Atomkraft bietet eine kontinuierliche Versorgung mit CO₂‑freier Energie, die insbesondere bei 24/7‑Rechenleistungen gefragt ist. Für die Tech-Wirtschaft ist der langfristige Zugang zu solcher Energie inzwischen ein Wettbewerbsfaktor.
Risiken und offene Baustellen
So viel Hoffnung der Atomkraft‑Renaissance innewohnt, so viele Unsicherheiten bestehen. Der Bau großer Reaktoren dauert oft über ein Jahrzehnt. Die Kosten sind schwer kalkulierbar – in den USA scheiterte kürzlich ein Großprojekt nach jahrelanger Verzögerung und Budgetexplosion. Auch neue SMRs könnten bei unklarer Nachfrage, Lieferkettenengpässen und regulatorischen Hürden unter Druck geraten.
Welche Risiken bremsen den globalen Ausbau der Kernenergie?
- Langwierige Genehmigungs- und Bauprozesse
- Hohe Investitionskosten und Finanzierungslücken
- Ungeklärte Endlagerfrage für hochradioaktiven Abfall
- Widerstand in der Bevölkerung
- Abhängigkeit von wenigen Lieferländern bei Uran
Regionale Entwicklungen: Ein Blick nach Europa und Asien
Während Deutschland und Österreich einen festen Ausstieg vertreten, setzen Länder wie Frankreich, Schweden, Tschechien oder Polen auf gezielten Ausbau. In Japan steigen nach Fukushima vorsichtig wieder Zustimmungswerte. Belgien diskutiert die Rücknahme des geplanten Ausstiegsdatums. In China werden bis 2030 mehr als 30 neue Reaktoren erwartet – ein gewaltiges Programm, das die Atomkraft global prägen könnte.
Welche Länder bauen 2025 neue Atomkraftwerke?
Besonders aktiv sind neben China auch Indien, Südkorea, Russland und Frankreich. In Europa forcieren Polen und die Slowakei neue Bauvorhaben, auch Rumänien und Bulgarien stehen wieder in der Planung.
Innovative Materialien und nächste Reaktorgeneration
Abseits der bekannten Entwicklungen entstehen auch Fortschritte bei Reaktormaterialien. Hochentropielegierungen und neuartige Keramiken zeigen hohe Strahlungsresistenz und werden als Hoffnungsträger für zukünftige Reaktorhüllen gehandelt. Sie könnten die Lebensdauer und Sicherheit von Reaktoren deutlich verbessern – befinden sich allerdings noch im Forschungsstadium.
Parallel entwickeln Staaten wie China und die USA neue Generation-IV-Reaktoren, darunter Flüssigsalz- und Bleikühlreaktoren. Der chinesische Hochtemperaturreaktor HTR‑PM ist bereits am Netz und liefert wichtige Daten für kommerzielle Nachfolger.
Ein neuer Energiemix – mit oder ohne Kernkraft?
2025 markiert einen Wendepunkt in der Energiepolitik: Die Welt befindet sich zwischen Klimadruck, geopolitischer Unsicherheit und wachsender Energienachfrage. Die Atomkraft erlebt ein Comeback – aber mit neuen Vorzeichen. Es geht nicht um die Rückkehr alter Großreaktoren, sondern um Innovation, Sicherheit, internationale Partnerschaften und gesellschaftliche Akzeptanz.
Deutschland bleibt vorerst Beobachter, könnte sich aber im Bereich Forschung, SMR‑Technik oder grenzübergreifender Netzwerke positionieren. Entscheidend wird sein, ob das Fenster der Chancen rechtzeitig genutzt wird – bevor der Energiebedarf die Optionen überholt.