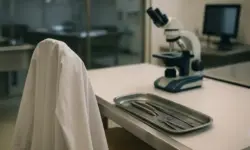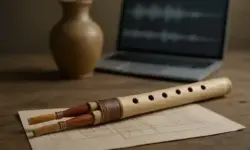Frankfurt am Main. Die Frankfurter Buchmesse 2025 bot nicht nur Neuerscheinungen aus Literatur und Medien, sondern auch ein Highlight für Sprachliebhaber: Die Verkündung des Jugendwortes des Jahres 2025. Jährlich vom Langenscheidt-Verlag organisiert, gilt die Wahl als Spiegel jugendlicher Kommunikationstrends – und sorgt traditionell für Diskussionen. Auch in diesem Jahr sorgte das Ergebnis für Aufsehen und Gesprächsstoff auf den Gängen der Messe.
Die Bühne für das Jugendwort des Jahres
Am 18. Oktober 2025 um 14:00 Uhr war es soweit: Im „Frankfurt Studio“ der Frankfurter Buchmesse wurde das Jugendwort 2025 offiziell verkündet. Der traditionsreiche Wettbewerb, der seit 2008 vom Langenscheidt-Verlag ausgerichtet wird, zieht jedes Jahr hunderttausende junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. In diesem Jahr wurden über zwei Millionen Stimmen abgegeben – ein neuer Rekord, der zeigt, wie groß das Interesse an Sprache und Kommunikation unter Jugendlichen ist.
Die Frankfurter Buchmesse bot mit ihrem internationalen Publikum den passenden Rahmen. Zwischen Verlagsständen, Lesungen und Talkrunden wurde das Event live gestreamt und auf Social Media begleitet. Besonders auf Plattformen wie Instagram und TikTok sorgten Hashtags wie #jugendwort2025, #checkstdu oder #dascrayzy für große Reichweite und teils hitzige Diskussionen.
Die Finalisten: Drei Wörter, drei Welten
In der Endrunde standen drei Wörter, die unterschiedlicher kaum sein könnten: „Checkst du“, „Das crazy“ und „Goonen“. Diese Auswahl spiegelte sowohl den kreativen Umgang junger Menschen mit Sprache als auch den Einfluss von Internetkultur und Memes wider.
| Wort | Bedeutung | Verwendung |
|---|---|---|
| Checkst du | Wird am Satzende verwendet, um sicherzugehen, dass das Gegenüber versteht, was gemeint ist. | „Das ist echt kompliziert, checkst du?“ |
| Das crazy | Ausdruck von Überraschung oder Sprachlosigkeit, oft humorvoll genutzt. | „Du hast echt acht Stunden gezockt? Das crazy!“ |
| Goonen | Jugendslang mit ursprünglich sexuellem Kontext; steht heute teils allgemein für „völlig abtauchen“ in eine Aktivität. | „Ich goone den ganzen Tag in Games ab.“ |
Wie läuft das Voting ab?
Viele fragen sich: Wie läuft das Voting für das Jugendwort 2025 ab? Der Prozess ist mehrstufig und transparent gestaltet. Von Ende Mai bis Mitte Juli konnten Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren ihre Vorschläge einreichen. Anschließend wählte der Verlag die Top 10 aus, über die öffentlich abgestimmt wurde. Danach folgte eine Finalrunde mit den drei meistgewählten Begriffen, über die bis zum 7. Oktober abgestimmt wurde. Die Verkündung auf der Messe markierte den Abschluss dieses demokratischen Sprachprojekts.
Wer bestimmt die Jugendkultur?
Der Langenscheidt-Verlag betont, dass das Jugendwort des Jahres nicht durch eine Jury, sondern durch die Jugendlichen selbst gewählt wird. Dennoch gibt es Kritik an der Methodik. Sprachwissenschaftler bemängeln seit Jahren, dass viele der ausgewählten Wörter bereits etabliert oder nur in bestimmten Online-Communities verbreitet seien. Der Soziologe Simon Schnetzer, der regelmäßig Jugendtrends untersucht, verweist in seiner Studie „Jugend in Deutschland 2025“ darauf, dass Begriffe wie „Digga“ oder „Bro“ im Alltag deutlich häufiger vorkommen als viele Gewinnerwörter der letzten Jahre.
Diese Diskrepanz zeigt, dass das Jugendwort weniger eine objektive Momentaufnahme, sondern vielmehr ein kulturelles Event ist – ein Sprachspiel, das die Medienlandschaft prägt. Oder wie ein Besucher auf der Buchmesse formulierte: Es geht nicht darum, wie wir wirklich reden, sondern wie wir über unsere Sprache reden.
Die Bedeutung hinter den Wörtern
„Checkst du“ – Kommunikation in Echtzeit
Das Wort „Checkst du“ ist ein Paradebeispiel für den Einfluss digitaler Kommunikation. In Chatnachrichten und Social-Media-Kommentaren dient es als rhetorisches Stilmittel, um Verständnis zu prüfen oder Zustimmung zu erzeugen. Es verdeutlicht, wie stark Sprache heute von kurzen, rhythmischen Sätzen geprägt ist – ein Spiegel moderner Gesprächskultur, in der Reaktionsgeschwindigkeit wichtiger ist als Grammatik.
„Das crazy“ – Anglizismus mit Witz
Der Ausdruck „Das crazy“ vereint ironische Selbstreflexion mit jugendlicher Spontaneität. Er stammt aus der Social-Media-Kommunikation, wo Nutzer Begriffe bewusst „falsch“ oder grammatikalisch unkonventionell einsetzen, um Humor zu erzeugen. Sprachforscher sehen darin ein typisches Beispiel für sogenannte „Creative Errors“ – also absichtliche Abweichungen, die Gruppenzugehörigkeit signalisieren.
„Goonen“ – Zwischen Tabu und Trend
Kaum ein Wort sorgte im Vorfeld so für Kontroversen wie „Goonen“. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Online-Szene und beschreibt ein exzessives Verhalten – meist im Zusammenhang mit digitalen Reizen oder Selbstbefriedigung. Inzwischen wird er teils ironisch verwendet, um jede Art von „Abtauchen“ oder „Sich-verlieren“ zu beschreiben. In Foren und Reddit-Threads diskutieren Nutzer, ob ein solcher Begriff in einem jugendbezogenen Wettbewerb überhaupt Platz haben sollte. Viele befürworten eine offene Sprachkultur, andere warnen vor Verharmlosung problematischer Inhalte.
Jugendsprache als Spiegel der Gesellschaft
Jugendsprache ist kein geschlossenes System, sondern ein dynamischer Prozess. Sie verändert sich mit Plattformen, Memes und Trends. Laut der Diskurs-Zeitschrift prägen soziale Medien den Wandel stärker als jede andere Quelle. Wörter verbreiten sich nicht mehr über Freundeskreise, sondern viral – über TikTok, Twitch oder Instagram. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen „Jugendsprache“ und „Internetkultur“ zunehmend.
Die Wahl des Jugendwortes dient daher nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Dokumentation sprachlicher Entwicklungen. Kritiker werfen dem Wettbewerb allerdings vor, mehr Marketing als Linguistik zu sein. Dennoch bleibt das Event ein erfolgreiches Vehikel, um junge Menschen für Sprache zu begeistern.
Warum wird die Wahl kritisiert?
Eine häufige Frage lautet: Warum wird die Wahl des Jugendwortes immer wieder kritisiert? Sprachwissenschaftler bemängeln, dass der Wettbewerb zu sehr auf mediale Aufmerksamkeit setzt und weniger auf empirische Sprachforschung. Zudem würden manche Wörter nur durch den Wettbewerb bekannt, ohne tatsächlich im Alltag junger Menschen verwendet zu werden. Trotzdem bleibt die jährliche Abstimmung ein populäres Ereignis, das Sprachbewusstsein schafft – und Gesprächsstoff liefert.
Statistiken, Beteiligung und Resonanz
Die Wahl 2025 erreichte laut Langenscheidt eine Beteiligung von über zwei Millionen Stimmen – doppelt so viele wie im Vorjahr. Etwa 60 % der Teilnehmer waren zwischen 13 und 18 Jahre alt, ein weiteres Viertel zwischen 19 und 25 Jahren. Die Social-Media-Aktivitäten rund um das Event erzielten mehrere Millionen Aufrufe.
Auf TikTok wurde der Hashtag #jugendwort2025 binnen 24 Stunden über 12 Millionen Mal aufgerufen. Besonders das Wort „Goonen“ sorgte für virale Reaktionen – von Memes über Parodien bis zu Aufklärungsvideos über dessen Herkunft. Diese Dynamik zeigt, wie Sprache und Social Media untrennbar miteinander verbunden sind.
Mehr als ein Sprachspiel – gesellschaftliche Wirkung
Abseits des Unterhaltungswerts verdeutlicht die Wahl zum Jugendwort 2025 gesellschaftliche Prozesse: Offenheit gegenüber neuen Ausdrucksformen, Humor im Umgang mit Sprache und das Bewusstsein, dass Identität auch über Kommunikation definiert wird. Jugendliche nutzen Sprache, um sich abzugrenzen – aber auch, um verstanden zu werden. Das Jugendwort ist daher nicht nur ein Trend, sondern ein sozialer Indikator.
Welche weiteren Wörter waren 2025 nominiert?
In den früheren Phasen der Abstimmung waren neben den drei Finalisten auch andere Begriffe im Rennen, etwa „Tuff“, „Lowkey“ oder „Digga“. Diese spiegeln unterschiedliche Facetten jugendlicher Ausdrucksweise wider – von Lässigkeit über Understatement bis hin zu emotionaler Nähe. Eine vollständige Liste der nominierten Begriffe zeigt, wie vielfältig Jugendsprache geworden ist:
- Digga(h)
- Lowkey
- Tuff
- Tot
- Schere
- Sybau
- Rede
Auch wenn viele dieser Wörter nicht den Sieg davontrugen, zeigen sie die kreative Vielfalt der Sprachentwicklung in der Jugendkultur.
Online-Diskussionen und Reaktionen
In sozialen Medien wurde die Verkündung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während viele Nutzer über die Doppeldeutigkeit des Begriffs „Goonen“ lachten, äußerten andere Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit. Der offizielle Instagram-Kanal von Langenscheidt reagierte mit einem humorvollen Kommentar: Sprache lebt – manchmal auch ein bisschen wild.
Diese Reaktionen belegen, dass Jugendsprache kein statisches Konstrukt ist, sondern ein soziales Experiment, das ständig neue Grenzen testet. Die Wahl zum Jugendwort 2025 zeigt dies exemplarisch: Ein Wettbewerb, der sowohl Sprachfreude als auch kulturelle Reflexion erzeugt.
Sprache, Medien und Identität
In einer Welt, in der digitale Kommunikation dominiert, wird Sprache zum Ausdrucksmittel von Zugehörigkeit. Das Jugendwort 2025 – ob man es nun für sinnvoll, albern oder provokant hält – steht für ein Stück Jugendkultur, das sich zwischen Meme-Humor, Selbstironie und gesellschaftlicher Beobachtung bewegt. Die Frankfurter Buchmesse bot hierfür die perfekte Bühne, denn sie verbindet Tradition mit Wandel – genau wie die Jugendsprache selbst.
Was bleibt nach der Buchmesse?
Mit der Verkündung des Jugendwortes endet nicht die Diskussion, sondern sie beginnt erst. Schulen, Medien und Elternhäuser greifen die Wörter auf, deuten sie, diskutieren sie – und manchmal übernehmen sie sie selbst. Die Debatte um „Goonen“, „Checkst du“ und „Das crazy“ zeigt, dass Sprache ein lebendiger Aushandlungsprozess bleibt. Sie verändert sich mit jeder Generation, jeder Plattform und jedem neuen Trend.
Ob das Jugendwort 2025 in den alltäglichen Sprachgebrauch übergeht oder bald wieder verschwindet, wird sich zeigen. Sicher ist nur: Die Begeisterung für Sprache – und die Lust am Spielen mit Worten – bleibt ein fester Bestandteil jugendlicher Identität. Und die Frankfurter Buchmesse hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur Bücher, sondern auch Sprache zum Ereignis machen kann.