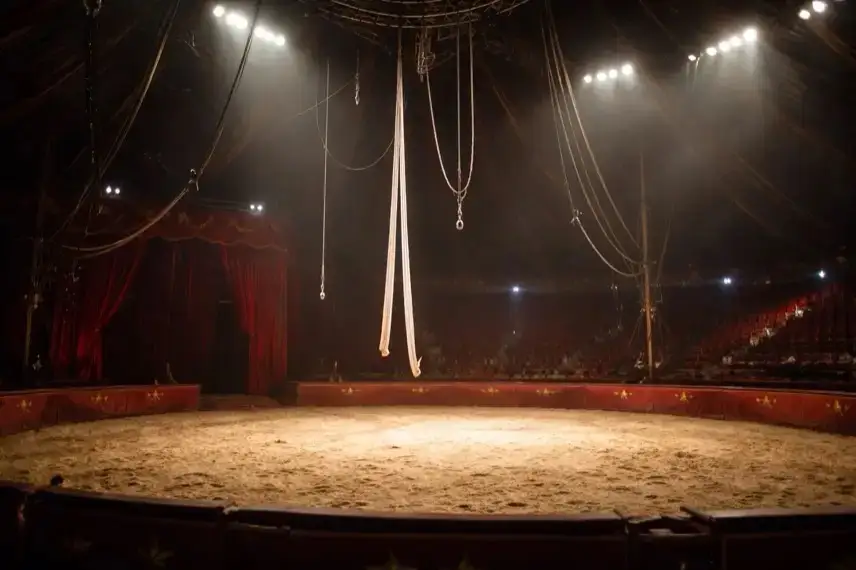STUTTGART – Die Landeshauptstadt Baden-Württembergs greift Hundehalter künftig tiefer in die Tasche. Nach fast drei Jahrzehnten ohne Anpassung steigt die Hundesteuer ab 2026 deutlich. Die Stadtverwaltung begründet den Schritt mit der angespannten Haushaltslage und der stark gestiegenen Zahl an Hunden in Stuttgart.
Hintergrund: Warum Stuttgart die Hundesteuer jetzt anhebt
In Stuttgart sind aktuell über 16.000 Hunde gemeldet – rund 5.000 mehr als noch im Jahr 2009. Diese Entwicklung spiegelt einen bundesweiten Trend wider: Während der Corona-Jahre haben sich viele Menschen einen Vierbeiner zugelegt. Die Stadtverwaltung sieht sich nun gezwungen, auf die steigenden Ausgaben und den wachsenden Pflegebedarf öffentlicher Flächen zu reagieren. In der Begründung zur Haushaltsberatung 2026/27 heißt es, die Hundesteuer sei „seit fast 30 Jahren unverändert“ geblieben und müsse nun an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst werden.
Bisher betrug die Hundesteuer in Stuttgart 108 Euro für den ersten Hund, 216 Euro für jeden weiteren und 612 Euro für sogenannte gefährliche Hunde. Künftig sollen diese Beträge deutlich steigen: Ab dem 1. Januar 2026 werden 144 Euro für den ersten Hund, 288 Euro für jeden weiteren und 816 Euro für gefährliche Hunde fällig. Damit liegt die Erhöhung bei etwa 33 bis 50 Prozent – je nach Hunderasse und Anzahl der Tiere.
Finanzielle Gründe im Vordergrund
Der Hauptgrund für die Steuererhöhung liegt in der Haushaltslage der Stadt. Stuttgart rechnet in den kommenden Jahren mit steigenden Ausgaben für Infrastruktur, Sicherheit und soziale Leistungen. Die Hundesteuer ist dabei eine verhältnismäßig einfach umsetzbare Einnahmequelle, die keine direkte Gegenleistung erfordert. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, haben die Kommunen deutschlandweit im Jahr 2023 rund 421 Millionen Euro aus der Hundesteuer eingenommen – ein Plus von über 40 Prozent gegenüber 2013. Auch Stuttgart will von diesem Wachstum profitieren.
Wie hoch ist die Hundesteuer künftig wirklich?
Nach den aktuellen Planungen gilt ab 2026 in Stuttgart folgende Staffelung:
| Kategorie | Bisher (Euro/Jahr) | Ab 2026 (Euro/Jahr) |
|---|---|---|
| Erster Hund | 108 | 144 |
| Zweiter und jeder weitere Hund | 216 | 288 |
| Gefährlicher Hund („Kampfhund“) | 612 | 816 |
Die Hundesteuer bleibt eine sogenannte Aufwandsteuer. Das bedeutet, dass die Stadt keine direkte Gegenleistung – etwa in Form zusätzlicher Hundewiesen oder Reinigungspersonal – erbringen muss. Die Einnahmen fließen in den allgemeinen Haushalt und dienen damit der Finanzierung kommunaler Aufgaben.
„Die Zahl der Hunde ist gestiegen, die Steuer nicht“
Mit diesen Worten begründet die Verwaltung den Schritt. Nach fast drei Jahrzehnten ohne Anpassung sieht man die Erhöhung als längst überfällig. Auch innerhalb des Gemeinderats gibt es Zustimmung: Einige Stadträte argumentieren, dass Halterinnen und Halter angesichts der steigenden Hundezahl stärker an den allgemeinen Kosten beteiligt werden sollten. Gegner wiederum befürchten, dass die Steuer zu Lasten sozial schwächerer Tierhalter geht, die sich ohnehin hohe Lebenshaltungskosten kaum leisten können.
Reaktionen aus der Bevölkerung und sozialen Medien
In den sozialen Netzwerken zeigt sich ein gemischtes Stimmungsbild. Unter einem Facebook-Post der „Stuttgarter Nachrichten“ diskutierten hunderte Nutzer die Maßnahme kontrovers. Viele begrüßen den Schritt mit dem Argument, wer sich einen Hund leisten könne, solle auch höhere Abgaben tragen. Andere fordern, dass die zusätzlichen Einnahmen zweckgebunden für Hundetoiletten, Kotbeutelspender oder Freilaufflächen verwendet werden sollten.
Ein Nutzer kommentierte: „Ich habe kein Problem mit der Steuer – aber dann sollte das Geld bitte in mehr Sauberkeit und Tütenspender investiert werden.“ Eine andere Nutzerin entgegnete: „Wir zahlen seit Jahren und sehen davon nichts. Für mich ist das nur eine weitere Einnahmequelle der Stadt.“
Diskussion in Foren und Bürgerhaushalt
Auch auf der Plattform des Bürgerhaushalts Stuttgart wird das Thema regelmäßig diskutiert. Während einige Bürger eine Erhöhung fordern, um „negative Externalitäten wie Hundekot im öffentlichen Raum zu kompensieren“, wünschen sich andere eine Senkung oder zumindest eine Zweckbindung. Die Debatte zeigt: Das Thema Hundesteuer berührt nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Aspekte des Zusammenlebens in der Stadt.
Deutschlandweiter Kontext und Vergleich
Ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus zeigt, dass Stuttgart mit der neuen Satzung im bundesweiten Mittelfeld liegt. In München zahlen Hundehalter aktuell 100 Euro für den ersten Hund, in Frankfurt 90 Euro, in Hamburg 90 Euro und in Berlin 120 Euro. Deutlich teurer ist es etwa in Düsseldorf mit 180 Euro pro Jahr. Damit bleibt Stuttgart trotz der Erhöhung im Vergleich nicht an der Spitze, aber doch oberhalb des Durchschnitts.
Hundesteuer als wachsender Einnahmefaktor
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die Einnahmen aus der Hundesteuer bundesweit von 300 Millionen Euro im Jahr 2013 auf über 420 Millionen Euro im Jahr 2023. Dies entspricht einer Steigerung um mehr als 40 Prozent. Der Grund: Zum einen halten mehr Menschen Hunde, zum anderen passen viele Städte ihre Satzungen an. Experten der Universität Göttingen weisen darauf hin, dass die Hundehaltung längst ein „ökonomischer Faktor mit gesellschaftlicher und emotionaler Dimension“ geworden sei.
Was Hundehalter jetzt wissen müssen
Wann und wie muss ich meinen Hund anmelden?
Wer einen Hund in Stuttgart hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Zuzug anmelden. Dies ist online, per Post oder persönlich beim Bürgerbüro möglich. Bei Zuzug aus einer anderen Stadt ist der Nachweis über bereits gezahlte Steuer hilfreich, um Doppelzahlungen zu vermeiden.
Was passiert bei Umzug oder Tod des Hundes?
Änderungen wie Umzug, Übergabe oder Tod des Hundes müssen unverzüglich gemeldet werden. Nur so kann die Steuerpflicht angepasst oder beendet werden. Wer dies versäumt, riskiert Nachzahlungen oder Bußgelder.
Gibt es Befreiungen oder Ermäßigungen?
Ja. Hunde, die aus Tierheimen übernommen werden, können in bestimmten Fällen von der Steuer befreit oder ermäßigt werden. Die Stadt Stuttgart gewährt auf Antrag entsprechende Nachlässe. Auch Blindenführhunde oder Diensthunde sind meist steuerbefreit.
Was gilt für gefährliche Hunde?
Als „gefährlich“ gelten in Baden-Württemberg bestimmte Rassen und Kreuzungen, etwa American Staffordshire Terrier, Bullterrier oder Pitbull Terrier. Für diese Tiere wird eine erhöhte Steuer erhoben – künftig 816 Euro im Jahr. Zusätzlich müssen Halter besondere Auflagen erfüllen, darunter Wesenstests und Leinenpflicht.
Hundehalter fordern Transparenz
In Online-Foren wie Reddit und Hundegruppen wird vor allem eines gefordert: Transparenz. Viele User beklagen, dass die Hundesteuer keine sichtbaren Verbesserungen bringe. „Man zahlt, aber es gibt kaum Mülleimer oder Freilaufflächen“, heißt es in einem vielzitierten Beitrag. Diese Kritik ist nicht neu – sie begleitet nahezu jede Erhöhung in deutschen Städten. Die Kommunen argumentieren hingegen, dass die Steuer nicht zweckgebunden sei und daher nicht zwingend für hundebezogene Ausgaben verwendet werden dürfe.
Zwischen Einnahmen und Akzeptanz
Die Hundesteuer ist eine der ältesten kommunalen Abgaben in Deutschland. Ursprünglich diente sie der Regulierung der Hundepopulation und der Deckung öffentlicher Reinigungskosten. Heute ist sie vor allem eine Einnahmequelle. Experten sehen darin eine legitime, aber symbolisch aufgeladene Steuerart. Je stärker die Einnahmen steigen, desto lauter wird der Ruf nach Rückkopplung der Mittel an die Tierhalter.
Statistische Einordnung und Bedeutung
Die Statistik zeigt deutlich: Mit jährlich über 400 Millionen Euro Einnahmen bundesweit gehört die Hundesteuer zu den stabilsten kommunalen Einnahmequellen. Die Erhebung verursacht vergleichsweise geringe Verwaltungskosten. Laut der Studie der Universität Göttingen beträgt ihr Anteil an den kommunalen Steuereinnahmen zwar nur rund 0,5 Prozent, doch gerade in Zeiten knapper Haushalte ist sie für viele Städte ein willkommener Baustein zur Haushaltskonsolidierung.
Hunde in Stuttgart – eine Stadtstatistik
- Gemeldete Hunde (2025): ca. 16.137
- Zuwachs seit 2009: + 5.000
- Steuer pro Ersthund ab 2026: 144 €
- Prognostizierte Mehreinnahmen: rund 1,5 Mio. € jährlich
Wie andere Städte reagieren
Stuttgart steht mit der Steuererhöhung nicht allein da. Auch Städte wie Mannheim, Ulm und Karlsruhe prüfen derzeit Anpassungen. Hintergrund ist häufig dieselbe Begründung: steigende Zahl von Haustieren, höhere Reinigungskosten und wachsender Druck auf die Stadtkassen. Dennoch wird vielerorts betont, dass die Hundesteuer nicht als „Strafsteuer“ zu verstehen sei, sondern als Beitrag zur kommunalen Finanzierung.
Langfristige Folgen und Perspektiven
Ob die Erhöhung langfristig Bestand hat, wird auch von der Akzeptanz der Bevölkerung abhängen. Sollte sich der Unmut in sozialen Netzwerken weiter verstärken, könnte der Gemeinderat gezwungen sein, über Zweckbindungen oder Rückführungen der Mittel nachzudenken. Denkbar wäre etwa die Finanzierung zusätzlicher Hundewiesen oder die Förderung von Tierheimen durch einen festen Prozentsatz der Einnahmen.
Ausblick: Steuer, Verantwortung und Zusammenleben
Die Diskussion um die Hundesteuer in Stuttgart berührt letztlich Grundfragen des urbanen Zusammenlebens. Während viele Bürger höhere Steuern als gerecht empfinden, wenn sie zu mehr Ordnung und Sauberkeit beitragen, bleibt die Herausforderung, diese Erwartungen zu erfüllen. Die Hundesteuer ist dabei mehr als nur eine Einnahme – sie ist ein Symbol für das Verhältnis zwischen Tierliebe, Verantwortung und öffentlichem Raum. Stuttgart steht nun vor der Aufgabe, diesen Balanceakt erfolgreich zu gestalten – zwischen finanzieller Notwendigkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz.