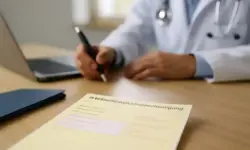Seit dem 1. Jänner 2024 hat sich für Millionen Haushalte in Österreich etwas Grundlegendes geändert: Die bisherige gerätebezogene GIS-Gebühr wurde durch eine verpflichtende Haushaltsabgabe ersetzt. Mit 183,60 Euro jährlich sorgt die neue Regelung für Diskussionen – zwischen verfassungsrechtlicher Legitimation, politischem Streit und der Frage: Ist das gerecht?
Die neue Haushaltsabgabe: Ein Überblick
Mit der Einführung der ORF-Haushaltsabgabe reagierte die österreichische Bundesregierung auf die zunehmende Unwirksamkeit der alten GIS-Regelung. Immer mehr Haushalte verfügten über keine klassischen Rundfunkgeräte mehr oder nutzten Streamingdienste. Die neue Abgabe ist unabhängig vom Gerätebesitz und verpflichtet alle Haushalte mit Hauptwohnsitz zur Zahlung – selbst wenn keine Nutzung des ORF-Angebots erfolgt.
Was kostet die Haushaltsabgabe?
Die neue Abgabe beträgt bundeseinheitlich 15,30 Euro im Monat – also 183,60 Euro im Jahr. In einigen Bundesländern kommen zusätzlich monatliche Landesabgaben hinzu, wodurch sich die Gesamtkosten deutlich erhöhen können.
| Bundesland | Landesabgabe (monatlich) | Gesamtkosten jährlich |
|---|---|---|
| Steiermark | 4,70 € | 240 € |
| Kärnten | 4,70 € | 240 € |
| Burgenland | 4,70 € | 240 € |
| Tirol | 3,10 € | 220,80 € |
| Wien, NÖ, OÖ, Salzburg, Vorarlberg | – | 183,60 € |
Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll durch diese Maßnahme stabilisiert werden. Gleichzeitig hat die Regierung angekündigt, den Beitrag bis 2029 nicht zu erhöhen.
Verfassungsgerichtliche Prüfung: Abgabe ist rechtmäßig
Mehrere Beschwerden gegen die neue Abgabe wurden vom Verfassungsgerichtshof geprüft – und abgewiesen. Die Richter urteilten, dass es dem Gesetzgeber zusteht, den ORF als „öffentlich-rechtliche Einrichtung im demokratischen Interesse“ auch unabhängig vom Medienkonsum jedes Einzelnen zu finanzieren. Eine Ungleichbehandlung sah der VfGH nicht gegeben.
Wer muss zahlen – und wer nicht?
Zahlungspflichtig sind alle volljährigen Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich. Die Beitragspflicht besteht pro Wohnadresse – unabhängig davon, wie viele Menschen dort leben oder ob tatsächlich ein Radio oder Fernseher genutzt wird.
Ausnahmen und Befreiungen
Von der Abgabe können unter bestimmten Bedingungen befreit werden:
- Menschen mit geringem Einkommen
- Empfänger von Pflegegeld
- Lehrlinge und Studierende mit Eigenhaushalt
Kritisch gesehen wird jedoch, dass Grundwehrdiener weiterhin keine automatische Befreiung erhalten. In Foren wird diese Regelung als „sozial unausgewogen“ bezeichnet.
Stimmen aus der Bevölkerung: Zwischen Verständnis und Wut
Die Umfragen zur Haushaltsabgabe zeichnen ein geteiltes Bild. Eine Mehrheit sieht die Zwangsabgabe kritisch. In einer Unique-Research-Erhebung sprachen sich über 70 % gegen die Verpflichtung aus, den ORF zu finanzieren, wenn man ihn selbst nicht nutze. In Onlineforen äußern sich Nutzer deutlich:
„Ich zahle 240 Euro im Jahr für etwas, das ich nicht konsumiere – das ist einfach absurd.“
„Der ORF soll unabhängig bleiben, ja. Aber dann bitte mit einem fairen Modell, das sich am Bedarf orientiert.“
Gleichzeitig gibt es auch Zustimmung zur Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Grundangebots, vor allem im Hinblick auf Nachrichten, Bildung und Katastrophenschutz.
Der ORF im politischen Kreuzfeuer
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist der Einfluss politischer Parteien auf den ORF. In Foren ist von „Postenschacher“ und „Instrumentalisierung des öffentlich-rechtlichen Mediums“ die Rede. Auch ehemalige „Sideletter“-Vereinbarungen zwischen Regierungsparteien zur Besetzung von ORF-Posten wurden öffentlich diskutiert und befeuern das Misstrauen weiter.
Volksbegehren gegen Haushaltsabgabe
Im Frühjahr 2025 wurde ein Volksbegehren gegen die Haushaltsabgabe mit über 119.000 Unterschriften unterstützt. Damit muss sich das Parlament verpflichtend mit dem Thema befassen. Das Ziel der Initiatoren: Abschaffung der Zwangsabgabe und Umstellung auf eine Finanzierung aus dem Bundesbudget oder über freiwillige Beiträge.
Internationale Vergleiche: Wo steht Österreich?
Ein Blick nach Europa zeigt: Österreich zählt zu den Ländern mit den höchsten Rundfunkbeiträgen. Zwar liegt Deutschland mit rund 210 Euro jährlich etwas höher, doch in Ländern wie Italien (90 €), Finnland (max. 160 €) oder Schweden (1 % des Einkommens) ist die Belastung für Haushalte teils deutlich geringer. Zudem orientieren sich viele Länder inzwischen am Prinzip: Wer nutzt, der zahlt – oder staffeln Beiträge nach Einkommen.
Unternehmen und Zweitwohnsitze: Wer noch betroffen ist
Auch Unternehmen sind betroffen: Pro Betriebsstätte und je nach Lohnsumme können mehrere Beiträge anfallen – bis zu 100 pro Unternehmen und Gemeinde. Das sorgt für Kritik seitens der Wirtschaftskammern, insbesondere kleiner Betriebe. Auch Besitzer von Zweitwohnsitzen müssen unter bestimmten Bedingungen mehrfach zahlen, was in Tourismusregionen wie Tirol und Salzburg für Ärger sorgt.
Automatisierung und Vollstreckung: Was passiert bei Nichtzahlung?
Wer der Zahlungspflicht nicht nachkommt, muss mit Mahnverfahren, Inkasso und im Extremfall Geldstrafen von bis zu 2.180 Euro rechnen. Ein automatischer Einzug über SEPA soll künftig möglich sein. Bereits registrierte Haushalte wurden automatisch umgestellt, Neuanmeldungen laufen über das Melderegister (ZMR).
Zukunft der Haushaltsabgabe: Was noch offen bleibt
Die Regierung hat angekündigt, die Höhe des Beitrags bis 2029 nicht zu erhöhen – als Ausgleich zu geplanten Einsparungen beim ORF. Gleichzeitig bleibt offen, ob das Finanzierungsmodell mittelfristig verändert wird. Die politische Debatte um die Gerechtigkeit des Modells und den Einfluss auf die Medienlandschaft ist in vollem Gange.
Ein Beitrag mit Konfliktpotenzial
Die ORF-Haushaltsabgabe ist mehr als nur eine Gebühr – sie ist ein Symbol für die Diskussion um Medienunabhängigkeit, Gerechtigkeit und politische Verantwortung. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin breite Unterstützung erfährt, sorgt die zwangsweise Finanzierung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Frust.
Ob sich das System bewährt oder grundlegend überdacht wird, hängt nicht nur von der politischen Willensbildung ab – sondern auch von der Akzeptanz in der Bevölkerung. Mit dem erfolgreichen Volksbegehren und wachsenden Diskussionen in sozialen Medien steht jedenfalls fest: Die Debatte ist noch lange nicht vorbei.