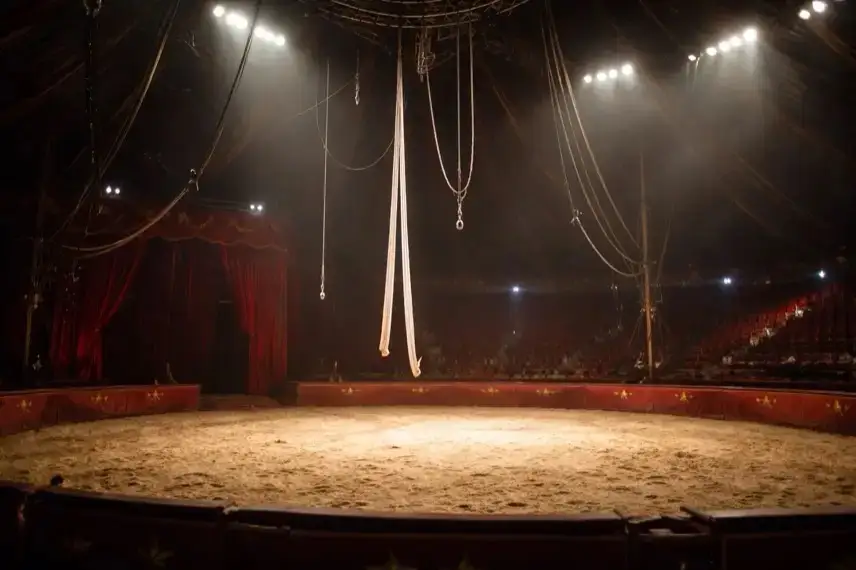Stuttgart – Eine gesetzliche Grauzone sorgt derzeit für hitzige Diskussionen: In der Landeshauptstadt erhalten zahlreiche Geflüchtete Bürgergeld, obwohl sie in Gemeinschaftsunterkünften vollständig verpflegt werden. Der Hintergrund ist komplex und wirft Fragen nach Gerechtigkeit, Kosten und sozialer Integration auf.
Wie eine rechtliche Lücke die Sozialpolitik herausfordert
In Stuttgart – wie auch in vielen anderen Kommunen – leben Geflüchtete oft in staatlich organisierten Gemeinschaftsunterkünften. In diesen Einrichtungen wird ihnen nicht nur eine Unterkunft gestellt, sondern vielfach auch eine vollständige Verpflegung angeboten. Zeitgleich beziehen viele dieser Menschen Bürgergeld nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Der Knackpunkt: Die Verpflegungsleistungen werden bislang nicht automatisch vom Bürgergeld abgezogen.
Diese Regelung sorgt für zunehmende Kritik – vor allem aus den Reihen der Kommunalpolitik. Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat hatte bereits 2023 darauf hingewiesen, dass die Stadt im Rahmen ihrer Unterbringungskosten auch die Verpflegung zahlt, während die Empfänger gleichzeitig die vollen SGB-II-Leistungen vom Jobcenter erhalten. „Es kann nicht sein, dass hier doppelt gezahlt wird“, heißt es aus dem politischen Lager.
Was regelt das Gesetz – und was nicht?
Das Bürgergeld basiert auf den Regelbedarfen des SGB II. Diese enthalten pauschale Beträge für Ernährung, Unterkunft, Mobilität, Gesundheit und Bildung. Zwar sind Sachleistungen in bestimmten Kontexten möglich, eine verpflichtende Anrechnung von Vollverpflegung in kommunalen Unterkünften ist jedoch nicht vorgesehen.
Mit Einführung des neuen § 68 SGB II im Jahr 2024 wurde zwar erstmals ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der Sachleistungen für Ernährung und Haushaltsenergie in den kommunalen Wohnformen ermöglicht. Doch selbst diese Regelung verpflichtet die Behörden nicht dazu, das Bürgergeld in voller Höhe zu kürzen. Die Umsetzung bleibt auf lokaler Ebene bislang vage.
Kann das Jobcenter Bürgergeld kürzen, wenn Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften verpflegt werden?
Nach aktueller Rechtslage: Nein. Eine automatische Kürzung oder Anrechnung der Verpflegung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Das Jobcenter handelt nur auf Grundlage klarer gesetzlicher Bestimmungen – und diese fehlen bisher.
Wie viele Menschen sind betroffen?
Bundesweit erhalten laut Statistischem Bundesamt mehr als 500.000 Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Gruppe ist davon jedoch nicht direkt betroffen, da sie meist keine Bürgergeldempfänger sind. Anders verhält es sich mit Geflüchteten, die nach Anerkennung ihres Asylantrags oder aufgrund anderer Duldungsgründe in das SGB-II-System übergehen.
In Stuttgart liegt die Zahl der Bürgergeldempfänger bei über 40.000 Menschen – darunter viele mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Auch wenn die genaue Anzahl derjenigen, die gleichzeitig verpflegt werden, nicht öffentlich bekannt ist, lässt sich festhalten: Der Personenkreis ist groß genug, um kommunale Haushalte merklich zu belasten.
Gibt es Landkreise oder Städte, die tatsächlich Verpflegung vom Bürgergeld abziehen?
Vereinzelte Kommunen wie Hamburg und Berlin prüfen Modelle zur anteiligen Abrechnung der Verpflegungskosten. Doch bislang existieren keine flächendeckend umgesetzten Verfahren, die den Abzug systematisch durchführen.
Die politische und gesellschaftliche Debatte
Während CDU-Vertreter in Stuttgart und anderswo auf Effizienz und Haushaltsgerechtigkeit pochen, sehen Sozialverbände und Organisationen wie Pro Asyl die Gefahr einer sozialen Spaltung. Wird die Debatte zu einseitig geführt, könnten Vorurteile gegen Geflüchtete verstärkt werden.
In sozialen Medien wird die Thematik stark emotionalisiert diskutiert. Ein Nutzer auf Reddit kommentiert etwa: „Die gucken mich erstaunt an, wenn ich sage, dass ich als Student kein Bürgergeld bekomme.“ Eine Aussage, die verdeutlicht, wie schnell sich Missverständnisse und Neiddebatten entwickeln können.
Können Geflüchtete gleichzeitig Bürgergeld und Vollverpflegung erhalten?
Ja. Solange es keine gesetzliche Regelung gibt, die beides miteinander verrechnet, ist diese Doppelleistung möglich – und wird faktisch in vielen Städten auch so praktiziert.
Missverständnisse und Fehlannahmen
Die Diskussion wird zusätzlich dadurch erschwert, dass selbst viele Geflüchtete nicht genau wissen, welche Leistungen ihnen tatsächlich zustehen. Die komplexen Regelwerke des SGB II und AsylbLG, gekoppelt mit bürokratischen Abläufen, sorgen für große Intransparenz. Hinzu kommt, dass in verschiedenen Unterkünften unterschiedliche Regelungen gelten – abhängig vom Träger, vom Bundesland und vom Status des Geflüchteten.
Gibt es bundesweite Verfahren zur Rückforderung von Verpflegungskosten bei Bürgergeld-Empfängern?
Nein. Bundesweit gibt es bislang keine einheitliche Praxis zur Rückforderung. Einzelne Pilotprojekte oder Konzepte existieren, etwa in Hamburg, aber ein geregeltes Verfahren ist nicht etabliert.
Kostendimensionen – ein relativer Streit?
Ein Aspekt, der in der politischen Diskussion häufig untergeht, ist die tatsächliche Größenordnung. In einem Thread auf Reddit kommentiert ein Nutzer: „Sind jedoch nur 0,46 % der Gesamtkosten fürs Bürgergeld. Wow, lohnt sich sehr.“ Tatsächlich ist der Anteil der Verpflegungskosten im Verhältnis zum gesamten Sozialetat gering. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kommunen finanziell nicht belastet wären – denn diese tragen oft die Kosten vor, bevor der Bund sie anteilig erstattet.
Welche Gesetzesänderung regelt seit 2024 die Anrechnung von Cateringkosten im SGB II?
Der neue § 68 SGB II, eingeführt zum 1. Januar 2024, erlaubt Sachleistungen in besonderen Wohnformen. Doch es fehlt eine verpflichtende Regelung zur Verrechnung mit dem Bürgergeld. Die Umsetzung bleibt damit in der Verantwortung der lokalen Träger.
Das Spannungsfeld zwischen Verwaltung, Gerechtigkeit und Integration
Die aktuelle Situation ist nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein soziales Problem. Bürgergeld soll Teilhabe und Integration fördern – keine Quelle für Stigmatisierung sein. Dennoch sehen viele Bürger die gleichzeitige Inanspruchnahme von Bürgergeld und Vollverpflegung als ungerecht an. Dieses Gerechtigkeitsempfinden spielt in der gesellschaftlichen Akzeptanz von Sozialleistungen eine zentrale Rolle.
Zugleich gibt es aus Sicht der Geflüchteten reale Herausforderungen: Ein Leben mit Bürgergeld ermöglicht kaum Rücklagenbildung, geschweige denn einen dauerhaften gesellschaftlichen Aufstieg. Das trifft nicht nur auf Geflüchtete zu, sondern auch auf viele langjährige Bürgergeldempfänger. Die strukturellen Ursachen von Armut und Ausgrenzung werden durch die aktuelle Debatte oft überdeckt.
Ab wann müssen Verpflegungskosten bei Bürgergeld-Empfängern angerechnet werden?
In Städten wie Hamburg gibt es Bemühungen, Verpflegungskosten über die Trägerstrukturen abzurechnen – aber dies betrifft nicht direkt die Bürgergeldzahlungen an die Empfänger. Eine pauschale Anrechnung auf individueller Ebene ist nicht vorgesehen.
Tabellarische Übersicht: Wer erhält was?
| Leistungsform | Gesetzliche Grundlage | Monatlicher Betrag (ungefähr) | Verpflegung inkludiert? |
|---|---|---|---|
| Asylbewerberleistung | AsylbLG | ca. 410 € | Ja, teils Sachleistung |
| Bürgergeld alleinstehend | SGB II | 563 € | Nein |
| Bürgergeld + Vollverpflegung | SGB II + kommunale Leistung | 563 € + Verpflegung | Ja, aktuell ohne Abzug |
Was jetzt passieren müsste
Die Problematik ist erkannt, die Gesetzeslage uneindeutig, und der politische Druck wächst. Es bleibt jedoch unklar, wann und ob der Gesetzgeber klare Regeln schaffen wird. Ein transparenteres, gerechteres und praxistaugliches Modell ist dringend erforderlich – sowohl im Sinne der Steuerzahler als auch der Betroffenen.
Der Fall Stuttgart zeigt exemplarisch, wie kommunale Realität und bundesrechtliche Regelungen nicht immer synchron laufen. Dabei wäre es im Sinne aller Beteiligten, Planungssicherheit zu schaffen: Für Behörden, für Leistungsempfänger – und für die Gesellschaft, die das System finanziert.
Statt reflexartiger Kürzungsforderungen und moralischer Aufladung braucht es nun eine ausgewogene und lösungsorientierte Debatte, die soziale Gerechtigkeit, Verwaltungseffizienz und gesellschaftlichen Zusammenhalt gleichermaßen berücksichtigt.