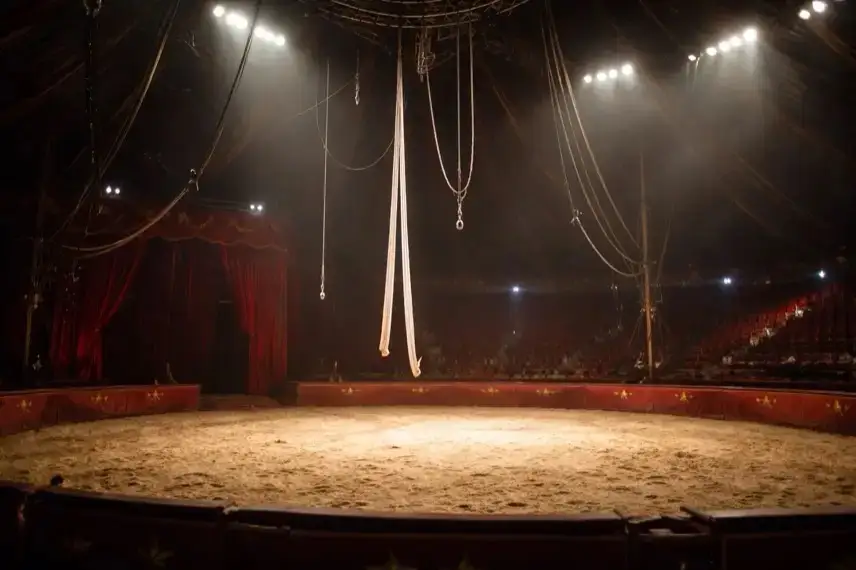Stuttgart – Zwei Wochen im Jahr, die viel mehr sind als nur ein Programmpunkt im Veranstaltungskalender: Die Aktionswochen gegen Rassismus in Stuttgart stehen für gesellschaftliche Verantwortung, kritische Auseinandersetzung und ein Miteinander, das Rassismus aktiv entgegenwirkt. 2025 feiert die Initiative ihr zehnjähriges Bestehen – und zeigt, wie engagierte Stadtgesellschaft aussehen kann.
Ein Jahrzehnt Engagement – Die Geschichte der Stuttgarter Aktionswochen
Die Aktionswochen gegen Rassismus in Stuttgart haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 zu einem bedeutenden Bestandteil des städtischen Kalenders entwickelt. Ursprünglich unter dem Titel „HEIMAT – Internationale Wochen gegen Rassismus“ gestartet, firmiert das Programm seit 2021 unter dem heutigen Namen und gehört zum bundesweiten Netzwerk im Rahmen der von den Vereinten Nationen initiierten Internationalen Wochen gegen Rassismus.
Der symbolträchtige Zeitraum – rund um den 21. März, den „Internationalen Tag zur Überwindung rassistischer Diskriminierung“ – ist dabei mehr als nur ein Datum: Es ist ein jährliches Zeichen für gelebte Demokratie. In Stuttgart wird dieses Zeichen durch über 60 beteiligte Partnerinstitutionen, zahlreiche Veranstaltungen und immer neue Formate mit Leben gefüllt.
Wo und wann finden die Aktionswochen statt?
Die Veranstaltungen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet – von Jugendhäusern in Degerloch über Schulen in Zuffenhausen bis zu Kultureinrichtungen in der Innenstadt. Auch digitale Formate spielen eine zunehmende Rolle. Die Aktionswochen 2025 starten am 17. März mit einer Eröffnungsveranstaltung im JES (Junges Ensemble Stuttgart) und enden am 29. März mit einem öffentlichen BarCamp im Jugendhaus Degerloch. Dazwischen finden zahlreiche Workshops, Lesungen, Filmvorführungen und Gesprächsrunden statt.
Wie ist das Programm aufgebaut?
Das Veranstaltungsangebot folgt einer klaren Struktur:
- Schulprogramm: Workshops, Vorträge und Projektarbeit mit Schüler*innen
- Fortbildungsformate: Angebote für Lehrkräfte, Verwaltung, Jugendarbeit und Multiplikator*innen
- Empowerment & Öffentlichkeit: Veranstaltungen für Betroffene, Kulturbühnen, Diskussionen, Stadtteilaktionen
Die Themen reichen von antimuslimischem Rassismus über diskriminierende Schönheitsideale bis hin zu intersektionaler Bildungsarbeit. Besonders im Jubiläumsjahr 2025 steht die Zukunftsfähigkeit im Fokus: Denkwerkstätten und offene Formate sollen neue Ideen für die kommenden Jahre liefern.
Wer steckt hinter den Aktionswochen?
Getragen werden die Aktionswochen gegen Rassismus vom Stadtjugendring Stuttgart e. V., dem Forum der Kulturen Stuttgart e. V., der Partnerschaft für Demokratie Stuttgart und zahlreichen Kooperationspartnern. Finanziert wird das Projekt durch städtische Mittel, Fördergelder aus Bundesprogrammen und Eigenleistungen der Partner.
Die Koordination übernimmt ein Leitungsteam in enger Zusammenarbeit mit einer offenen Konzeptgruppe, die sich jährlich neu zusammensetzt. So bleibt das Programm dynamisch, aktuell und orientiert sich an den Bedarfen der Stadtgesellschaft.
Empowerment statt Ohnmacht: Angebote für Betroffene
Ein zentrales Element der Aktionswochen ist das Empowerment-Programm. Es richtet sich explizit an Menschen, die Rassismuserfahrungen machen – mit dem Ziel, Räume für Selbstermächtigung, Austausch und Stärkung zu schaffen. Neben Workshops zu Selbstfürsorge, mentaler Gesundheit oder Empowerment-Gesang gibt es auch Formate wie das „Community Cooking“ oder Safe-Space-Dialoge.
„Wir brauchen sichere Räume, in denen unsere Stimmen gehört werden und wir uns ohne Angst artikulieren können“, heißt es aus der Empowerment-Konzeptgruppe. Diese Perspektive zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Programm.
Warum sind solche Angebote notwendig?
Die Zahlen sprechen für sich: Über 54 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund erleben laut aktuellen Studien regelmäßig Diskriminierung. Dabei geht es nicht nur um offene Feindseligkeit, sondern auch um subtile, strukturelle Ausgrenzungen – im Bildungswesen, im Arbeitsmarkt oder in Behörden. So gaben 19 % der Befragten in einer bundesweiten Studie an, sich von staatlichen Institutionen ungerecht behandelt zu fühlen.
Junge Menschen sind besonders betroffen. Laut der SVR-Studie „YoungUP“ aus dem Jahr 2025 fühlen sich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund politisch nicht repräsentiert. Ihre Teilhabe werde erschwert, ihre Erfahrungen würden oft ignoriert. Genau hier setzen Formate wie die Empowerment-Workshops der Aktionswochen an.
Wie läuft die Anmeldung für Veranstaltungen?
Interessierte Gruppen und Einzelpersonen können sich über die offizielle Webseite anmelden. Viele Angebote – vor allem im Schul- und Fortbildungsbereich – sind kostenfrei. Bereits im Oktober des Vorjahres startet die Phase, in der Kooperationspartner eigene Veranstaltungsformate anmelden können. Die Konzeptgruppe prüft dann Inhalte und Finanzierungsrahmen.
Welche Themen bewegen Stuttgart besonders?
Ein Blick auf das Veranstaltungsarchiv zeigt: Stuttgart beschäftigt sich intensiv mit Themen wie antimuslimischem Rassismus, Alltagsdiskriminierung, postkolonialen Perspektiven und BIPoC-Erfahrungen. 2025 wird zusätzlich auf Barrierefreiheit und Inklusion geachtet. Denkwerkstätten zu Allyship, Bildungsarbeit und Community-Pflege sollen langfristige Strukturen anstoßen.
Beispielhafte Veranstaltungsformate:
| Format | Zielgruppe | Ort |
|---|---|---|
| Empowerment-Karaoke | BIPoC Jugendliche | Jugendhaus Mitte |
| Denkwerkstatt „Allyship“ | Multiplikator*innen | Forum der Kulturen |
| Filmabend „Uncivilized“ | Öffentlichkeit | Mosaik Stuttgart |
Wie sichtbar sind die Aktionswochen in der Stadt?
Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über verschiedene Kanäle: Social Media (Instagram, Facebook), Plakataktionen, Newsletter, Pressemitteilungen und Veranstaltungen mit prominenter Unterstützung. So unterstützte Ex-VfB-Torwart Timo Hildebrand öffentlich die Kampagne, ebenso wie der VfB Stuttgart mit einem Videoaufruf gegen Rassismus.
Auf Instagram werden Formate beworben, Erfahrungsberichte geteilt und Räume geschaffen, in denen Betroffene sichtbar werden. Diese gezielte Öffentlichkeitsarbeit trägt zur Reichweite und Sichtbarkeit der Aktionswochen bei.
Wer darf teilnehmen – und wer nicht?
Grundsätzlich sind die Veranstaltungen offen für alle. Allerdings behalten sich die Organisator*innen ausdrücklich vor, Menschen mit nachweislich rechtsextremem Hintergrund den Zugang zu verwehren. Dies ist ein klares Bekenntnis zu demokratischen Werten und ein Schutzmechanismus für Betroffene, die an Empowerment-Formaten teilnehmen.
Wie geht es weiter mit den Aktionswochen?
Mit dem Jubiläum 2025 steht eine Phase der Neuausrichtung an. Die klassischen Formate werden durch offene Denkwerkstätten ersetzt. Die Ergebnisse des BarCamps zum Abschluss der Aktionswochen sollen in ein neues Leitbild münden, das die kommenden Jahre prägt. Die Organisator*innen sehen darin eine Chance: mehr Partizipation, mehr Selbstorganisation, mehr Wirkung.
Ein zivilgesellschaftliches Labor für Demokratie
Die Aktionswochen gegen Rassismus in Stuttgart sind mehr als eine Veranstaltungsreihe. Sie sind ein Spiegelbild des Engagements einer Stadt, die ihre Vielfalt lebt – aber auch deren Herausforderungen nicht verschweigt. Durch Empowerment, Bildung, Vernetzung und kreative Formate gelingt es, Diskriminierung nicht nur zu thematisieren, sondern aktiv zu bekämpfen.
In einer Zeit, in der demokratische Werte zunehmend unter Druck stehen, setzt Stuttgart ein deutliches Zeichen: gegen Rassismus, für Teilhabe, Vielfalt und Respekt. Und dieses Zeichen wird von Jahr zu Jahr sichtbarer.