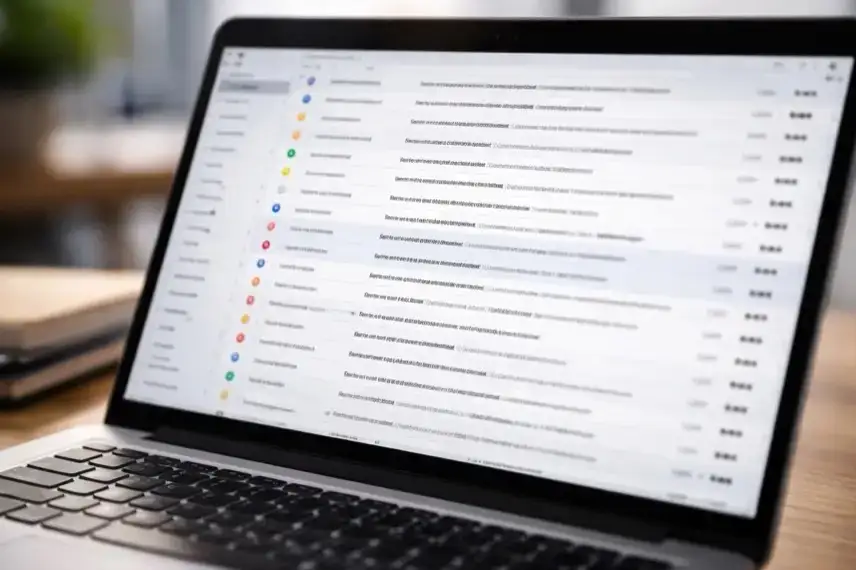Gelsenkirchen – Eine Entscheidung der Gesamtschule Erle sorgt derzeit bundesweit für Diskussionen. Ab dem kommenden Schuljahr wird in der Mensa ausschließlich halal-zertifiziertes Fleisch angeboten – begleitet von vegetarischen Alternativen. Was als Zeichen der Inklusion gedacht war, entfacht eine Kontroverse über Religionsfreiheit, staatliche Neutralität und Vielfalt an deutschen Schulen.
Eine Entscheidung mit Signalwirkung
Die Einführung ausschließlich halal-zertifizierter Fleischgerichte an der Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen ist nicht nur eine lokale Veränderung im Speiseplan, sondern ein Symbol: für gelingende Integration – oder für die wachsende Spannung zwischen kultureller Anpassung und pluralistischer Gesellschaft, je nachdem, wen man fragt. Der Schulträger rechtfertigt die Umstellung mit der Zusammensetzung der Schülerschaft. Rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen an der Schule stammen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Viele davon sind muslimischen Glaubens.
„Wir wollen, dass alle Schüler mitessen können, ohne sich ausgeschlossen zu fühlen“, sagt eine Sprecherin des Caterers. Das Unternehmen, das neun weitere Schulen in Gelsenkirchen versorgt, setzt damit auf einen einheitlichen Standard – halal-konform für alle. Gleichzeitig gibt es täglich vegetarische Alternativen, eine Salatbar und Nudelgerichte. Schweinefleisch wird bereits seit Jahren nicht mehr angeboten.
Kritik aus Wissenschaft und Politik
Doch die Entscheidung bleibt nicht unwidersprochen. Die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter sieht in dem Vorgehen keine Förderung von Vielfalt, sondern das Gegenteil. „Man fördert keine Vielfalt, sondern Einfalt“, erklärte sie in einem Interview. Auch der Extremismus-Experte Ahmad Mansour warnte: „Dass eine gesamte Schule unterwandert wird, ist kein Ausdruck von Toleranz.“
Diese Aussagen spiegeln eine verbreitete Sorge wider: Wenn religiöse Normen zur Norm für alle werden, wird das Prinzip der Neutralität untergraben. Die Frage, ob Halal-Fleisch in deutschen Schulen überhaupt erlaubt ist, wird zwar rechtlich eindeutig beantwortet – ja, es darf angeboten werden –, doch der Streit beginnt bei der Frage, ob es verpflichtend für alle sein sollte.
Was bedeutet „halal“ eigentlich?
Im arabischen Sprachgebrauch bedeutet „halal“ schlicht „erlaubt“. Auf Lebensmittel bezogen, umfasst es Richtlinien, die unter anderem das Schlachten von Tieren, den Verzicht auf Alkohol oder bestimmte Zusätze betreffen. Doch halal ist mehr als Ernährung: Es steht für ein ethisch-moralisches System, das auch wirtschaftliches Handeln, soziale Gerechtigkeit und Lebensweise umfasst. Damit gewinnt der Begriff in einem säkularen Schulsystem eine zusätzliche Bedeutungsebene.
Eine Frage der Perspektive: Was sagen Eltern und Schüler?
In Internetforen wie Rabeneltern.org oder Reddit diskutieren Eltern teils hitzig über den Wandel. Ein oft genannter Punkt: die Bevorzugung religiöser Wünsche gegenüber gesundheitlichen Notwendigkeiten. So schrieb eine Nutzerin: „Wir sind selbst Fleischesser, aber ich verstehe einfach nicht, warum religiöse Gründe berücksichtigt werden, nicht aber gesundheitliche Gründe wie Allergien.“
Auch das Thema Vielfalt wird kritisch gesehen. Wenn alle Schüler dasselbe essen müssen – halal-konform oder vegetarisch –, dann wird ihnen die freie Wahl genommen. Einige befürchten zudem eine „schleichende Normierung“ und fordern, dass auch koschere oder andere religiöse Standards berücksichtigt werden müssten, wenn man Gerechtigkeit anstrebt.
Wie wirkt sich eine Halal-Einführung auf die Essensbeteiligung aus?
Erfahrungen aus anderen Städten zeigen ein gemischtes Bild. In Hamburg-Billstedt stieg die Beteiligung am Schulessen stark an, als Halal-Optionen eingeführt wurden. Gleichzeitig berichteten Eltern über Probleme, weil parallele Produktionslinien für Halal und Nicht-Halal wirtschaftlich kaum zu stemmen seien. In vielen Fällen blieb dann Halal – mit vegetarischer Alternative – die einzige Option.
Organisatorische Gründe: Wirtschaftlichkeit und Logistik
Caterer argumentieren, dass die Einführung eines einheitlichen, halal-konformen Angebots wirtschaftlich sinnvoller sei als das Anbieten mehrerer Menülinien. Es sei schlicht zu teuer und logistisch aufwendig, Halal und Nicht-Halal parallel zu führen. Zudem geben viele Anbieter an, dass das Fleisch ohnehin betäubt und nach deutschem Tierschutzrecht geschlachtet wird – das Halal-Siegel sei in vielen Fällen eher symbolisch.
Diese Praxis ist in Deutschland durchaus verbreitet: Schweinefleisch verschwindet bereits seit Jahren aus Schul- und Kitaküchen, besonders in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder dem Ruhrgebiet. Schon 2016 berichteten Beobachter, dass der Wandel still und schrittweise erfolgte, lange bevor eine öffentliche Debatte darüber entbrannte.
Was sagen die Zahlen?
Statistiken belegen den Trend: Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollen Schulmensen ohnehin maximal zwei Fleischmahlzeiten pro Woche anbieten, davon eine mit Geflügel. Schweinefleisch fällt dabei aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen zunehmend weg. Zudem zeigen Umfragen, dass 63 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vegetarische Alternativen an Schulen befürworten – sieben Prozent sogar ein rein vegetarisches Angebot.
Damit passt die Entscheidung der Gesamtschule Erle in eine größere Entwicklung. Gleichzeitig verweist sie auf den schmalen Grat zwischen Rücksichtnahme und Überbetonung religiöser Standards.
Lehnen muslimische Familien Halal-Menüs überhaupt ab?
Interessanterweise berichten Lehrer:innen und Eltern aus der Praxis, dass viele muslimische Familien kein strikt halal-zertifiziertes Fleisch verlangen. Oft reicht der Verzicht auf Schweinefleisch aus. Eine Mutter aus einem Elternforum schrieb: „Meine Erfahrung sagt, die wenigsten bestehen auf halal. Sonst wäre ja meine halbe Schulküche leer.“
Ein weiteres Problem ist die Vielfalt der Halal-Zertifikate. Es gibt keine einheitliche Norm, und verschiedene islamische Gruppen erkennen unterschiedliche Standards an. Die Entscheidung für ein bestimmtes Siegel kann wiederum zur Ausgrenzung anderer führen.
Staatliche Neutralität oder pragmatische Inklusion?
Im Zentrum der Diskussion steht letztlich eine zentrale Frage: Wie weit darf oder muss staatliche Rücksichtnahme auf religiöse Bedürfnisse gehen? Die Bundesrepublik garantiert Religionsfreiheit – doch gleichzeitig verpflichtet sie sich zur weltanschaulichen Neutralität. Wenn Halal-Angebote zur verpflichtenden Norm werden, gerät dieses Gleichgewicht ins Wanken.
Viele Pädagog:innen empfehlen deshalb, vegetarische Optionen als verbindliche Basis in Schulmensen zu etablieren. Sie gelten als die inklusivste Lösung, weil sie keine religiösen oder kulturellen Ausschlüsse mit sich bringen – und auch gesundheitlich von Vorteil sind. Die nationale Initiative IN FORM bekräftigt diesen Ansatz.
Wie erkennt man ein echtes Halal-Zertifikat?
Eltern, die sichergehen wollen, dass das Schulessen tatsächlich halal ist, können auf Prüfsiegel achten oder spezielle Apps wie „Halal Check“ verwenden. Diese prüfen Inhaltsstoffe, E-Nummern und Herstellungsweise – doch auch hier gilt: Es gibt keine zentrale Zertifizierungsstelle, was die Orientierung erschwert.
Ein Thema, das weiter polarisiert
Die Debatte rund um Halal-Essen an Schulen steht beispielhaft für die größeren Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft. Zwischen dem Wunsch nach Inklusion und dem Anspruch auf Neutralität verläuft eine sensible Linie, die schwer zu balancieren ist. Während die einen in der Gelsenkirchener Entscheidung ein positives Zeichen für Integration sehen, fürchten andere die Dominanz religiöser Normen im öffentlichen Raum.
Fest steht: Ernährung ist längst mehr als nur Geschmack oder Sättigung – sie ist ein politisches, kulturelles und ideologisches Spielfeld geworden. Die Schulmensa ist in diesem Spannungsfeld zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse geworden.
Wie diese Prozesse künftig gestaltet werden, wird nicht nur vom Catering abhängen, sondern auch vom Dialog zwischen Schulen, Eltern, Schüler:innen und der Politik. Nur so lässt sich der Spagat meistern zwischen Rücksicht und Freiheit, zwischen Vielfalt und Einheit.