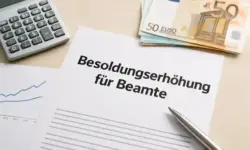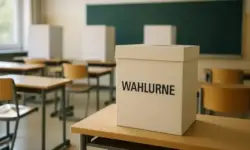Berlin, 8. November 2025. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat ein neues Gesetzesvorhaben angekündigt, das gezielte voyeuristische Aufnahmen künftig unter Strafe stellen soll. Anlass sind mehrere Fälle heimlicher Filmaufnahmen, bei denen bestehende Strafnormen nicht griffen. Das Justizministerium will bis Anfang 2026 einen praxistauglichen Gesetzentwurf vorlegen, um bestehende Lücken im Strafrecht zu schließen.
Gesetzesinitiative gegen digitale und analoge Formen des Voyeurismus
Nach Angaben des Bundesjustizministeriums zielt das geplante Gesetz darauf ab, sexuell motivierte Aufnahmen zu bestrafen, die bislang nicht vom Strafgesetzbuch erfasst werden. Konkret geht es um Fälle, in denen Personen bekleidet gefilmt werden, etwa beim Fokussieren auf Gesäß oder andere Körperpartien, ohne dass der Intimbereich sichtbar ist. Solche Aufnahmen sind nach aktueller Rechtslage in der Regel nicht strafbar, obwohl sie eindeutig mit sexueller Motivation erfolgen können.
Der Anlass für die Reform liegt unter anderem in einem Fall aus Köln, bei dem eine Joggerin während des Laufens heimlich gefilmt wurde. Die Frau konnte zwar Anzeige erstatten, doch rechtliche Schritte waren nicht möglich, da die bestehende Gesetzeslage keinen entsprechenden Tatbestand vorsah. Der Fall gilt seither als Symbol für eine Schutzlücke im deutschen Strafrecht.
Stefanie Hubig betonte, dass Frauen sich im öffentlichen Raum so selbstverständlich bewegen können sollten wie Männer. Diese Aussage fiel im Zusammenhang mit der geplanten Verschärfung des Strafrechts, die sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene diskutiert wird. Auf der Herbsttagung der Justizministerinnen und -minister der Länder wurde das Thema offiziell behandelt. Dabei wurde vereinbart, dass bis Anfang 2026 ein Gesetzentwurf ausgearbeitet werden soll.
Der aktuelle Rechtsstand und bestehende Gesetzeslücken
Derzeit gilt § 184k Strafgesetzbuch (StGB), der das Filmen des Intimbereichs – etwa von Genitalien, dem Gesäß oder durch Unterwäsche bedeckten Körperpartien – unter Strafe stellt. Ebenso greift § 201a StGB, wenn Aufnahmen den höchstpersönlichen Lebensbereich verletzen, beispielsweise in privaten Räumen oder Umkleiden. Nicht erfasst sind jedoch Aufnahmen, die Personen in der Öffentlichkeit zeigen, wenn keine Entblößung oder Umgehung eines Sichtschutzes vorliegt. Genau hier setzt der geplante neue Straftatbestand an.
In einer Erläuterung der geplanten Gesetzesänderung heißt es, dass nicht jede zufällige Aufnahme strafbar sein soll. Das bedeutet, dass etwa Landschafts- oder Gruppenfotos, auf denen zufällig Personen zu sehen sind, weiterhin erlaubt bleiben. Ziel ist die gezielte Erfassung solcher Handlungen, bei denen das Filmen einer Person eindeutig zur sexuellen Erregung oder Herabwürdigung erfolgt.
Warum ist das Filmen bekleideter Personen bisher nicht strafbar?
Die derzeitige Rechtslage unterscheidet streng zwischen Aufnahmen des Intimbereichs und bekleideten Körperpartien. Wenn eine Person mit Kleidung gefilmt wird, liegt kein Umgehen eines Sichtschutzes vor – ein zentrales Kriterium des § 184k StGB. Damit bleibt das gezielte Filmen des bekleideten Gesäßes oder anderer Körperbereiche meist straffrei, selbst wenn es eine sexuelle Motivation gibt.
Juristische Fachverbände wie der Deutsche Juristinnenbund bezeichnen dies als „bildbasierte sexualisierte Gewalt“. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2025 wurde betont, dass solche Handlungen eine massive Form digitaler Gewalt darstellen und gesetzlich bislang unzureichend erfasst werden. Das neue Gesetz soll diese Lücke schließen.
Unterstützung aus den Ländern und Fachkreisen
Unterstützung für die geplante Reform kommt aus mehreren Bundesländern. Der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach sprach sich für eine umfassende Überarbeitung des Sexualstrafrechts aus. Ziel sei es, den Schutz vor digitaler Gewalt im öffentlichen Raum zu verbessern. Auch der Landtag in Düsseldorf befasste sich mit dem Thema, wobei das Filmen und Verbreiten heimlicher Aufnahmen im Mittelpunkt stand.
Auf der Länderkonferenz wurde zudem erörtert, dass die Reform Teil einer breiteren Strategie gegen digitale Formen der Belästigung werden soll. Dazu gehören nicht nur voyeuristische Aufnahmen, sondern auch Deepfake-Darstellungen und synthetische Intimabbildungen. Eine internationale Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmenden zeigte, dass rund 2,2 Prozent der Befragten bereits Opfer nicht-einvernehmlicher synthetischer Intimabbildungen waren. Diese Zahl verdeutlicht, dass digitale Übergriffe ein wachsendes globales Phänomen darstellen.
Statistische Hintergründe und gesellschaftliche Relevanz
Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2024 mehr als 17.000 Fälle digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen registriert. Fachleute gehen jedoch von einer erheblich höheren Dunkelziffer aus. Viele Betroffene melden die Taten nicht, weil die aktuelle Rechtslage unklar ist oder keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Die geplante Gesetzesänderung soll somit auch eine präventive Wirkung entfalten.
| Jahr | Registrierte Fälle digitaler Gewalt (BKA) | Erfasste Opfergruppe |
|---|---|---|
| 2022 | ca. 14.500 | überwiegend Frauen |
| 2023 | ca. 15.800 | überwiegend Frauen |
| 2024 | über 17.000 | überwiegend Frauen |
Die Daten belegen eine steigende Tendenz digitaler Übergriffe. Neben strafrechtlichen Maßnahmen fordern Fachorganisationen eine bessere Erfassung solcher Delikte und mehr Aufklärungsarbeit über digitale Gewaltformen. Der Deutsche Juristinnenbund weist in seinen Veröffentlichungen darauf hin, dass die rechtliche Definition von „digitaler Gewalt“ in Deutschland bislang nicht einheitlich ist und Fälle wie voyeuristische Aufnahmen oft nicht eindeutig zugeordnet werden können.
Was gilt derzeit als strafbarer Voyeurismus?
Nach der aktuellen Rechtslage ist das heimliche Filmen oder Fotografieren von Personen vor allem dann strafbar, wenn ein geschützter Bereich betroffen ist. Dazu zählen etwa das Umkleiden, Duschen oder andere Situationen, in denen Intimsphäre erwartet werden kann. Wird hingegen eine Person im öffentlichen Raum gefilmt, ohne dass ein solcher Schutzbereich vorliegt, greift das Strafrecht meist nicht. Mit der geplanten Reform soll dieser Unterschied angepasst werden.
Gesellschaftliche Debatte und öffentliche Resonanz
Die Diskussion um das Thema Voyeurismus wird auch in sozialen Medien intensiv geführt. Auf Plattformen wie Instagram und Reddit äußern sich Betroffene und Beobachter über persönliche Erfahrungen und rechtliche Unsicherheiten. Besonders in Foren wird das Thema unter dem Begriff „Creepshots“ thematisiert, der sich auf heimlich aufgenommene Fotos von Frauen in der Öffentlichkeit bezieht. Zahlreiche Beiträge zeigen, dass diese Inhalte in der Vergangenheit sogar systematisch verbreitet wurden, bevor Plattformen einschritten und entsprechende Foren sperrten.
Parallel dazu fordern zivilgesellschaftliche Initiativen in Online-Petitionen eine klare gesetzliche Regelung. Eine der zentralen Forderungen lautet, dass sexuell motiviertes Filmen unabhängig von nackter Haut und unabhängig vom Ort – ob privat oder öffentlich – unter Strafe gestellt werden soll. Dabei wird besonders auf die einfache Beweisbarkeit durch Videomaterial verwiesen, die Strafverfolgung erleichtern könnte.
Welche Folgen drohen künftig bei strafbaren heimlichen Aufnahmen?
Nach derzeitiger Rechtslage droht bei Verstößen gegen § 184k StGB oder § 201a StGB eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Sollte das geplante Gesetz verabschiedet werden, ist davon auszugehen, dass sich der Strafrahmen daran orientiert. Ziel ist es, eine klare und abschreckende Regelung zu schaffen, die Opfer besser schützt und Tätern die Rechtswidrigkeit ihres Handelns verdeutlicht.
Juristische und gesellschaftliche Herausforderungen
Die Reformdiskussion verdeutlicht die Schwierigkeit, den rechtlichen Rahmen an technologische Entwicklungen anzupassen. Digitale Geräte ermöglichen heute Aufnahmen in nahezu jeder Situation, oft unbemerkt und mit hoher Bildqualität. Damit steigt das Risiko missbräuchlicher Nutzung, während das Strafrecht vieler Länder noch auf klassische Formen von Intimitätsverletzungen ausgelegt ist. Die geplante Reform soll diese Lücke zwischen technischer Realität und rechtlicher Kontrolle verkleinern.
Juristische Fachkreise weisen zugleich darauf hin, dass Gesetze allein keine vollständige Lösung bieten. Eine internationale Studie zeigte, dass auch in Ländern mit bestehenden Regelungen gegen nicht-einvernehmliche Aufnahmen oder Deepfakes die Verbreitung solcher Inhalte nicht vollständig verhindert werden konnte. Daher wird begleitend zur Gesetzgebung über Präventions- und Bildungsmaßnahmen diskutiert.
Perspektiven und weitere Schritte
Das Bundesjustizministerium will die Arbeiten am Gesetzentwurf bis Anfang 2026 abschließen. Danach soll der Entwurf dem Bundestag zur Beratung vorgelegt werden. Parallel wird auf Landesebene weiter diskutiert, welche flankierenden Maßnahmen nötig sind, um die Strafverfolgung effizienter zu gestalten. Dazu zählen Schulungen für Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften, eine einheitliche Definition digitaler Gewalt sowie eine stärkere Vernetzung von Opferhilfeeinrichtungen.
Der Fall der Kölner Joggerin hat verdeutlicht, dass das Strafrecht bei modernen Formen von Belästigung und digitalem Voyeurismus bislang unzureichend reagiert. Die angekündigte Reform könnte daher ein entscheidender Schritt sein, um bestehende Schutzlücken zu schließen und den rechtlichen Rahmen an die digitale Realität anzupassen.