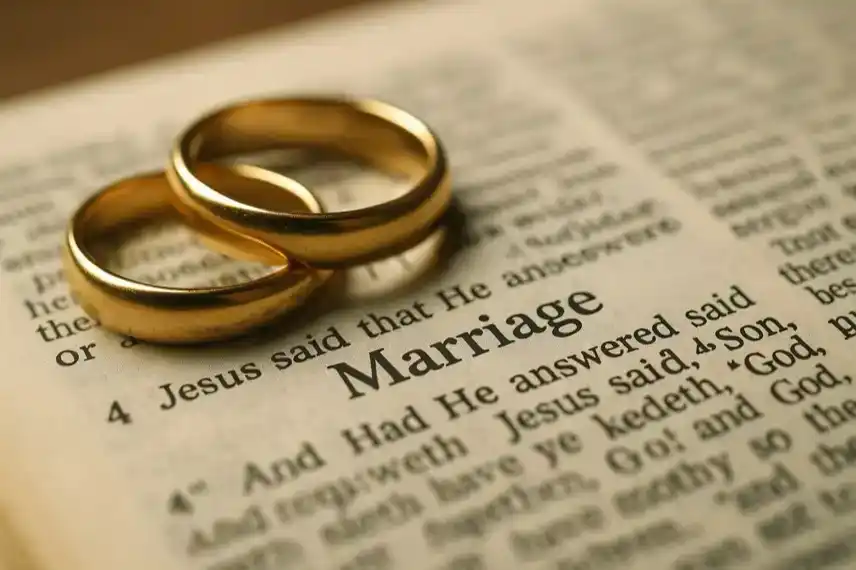
Der Rücktritt des deutschstämmigen Bischofs Reinhold Nann im Jahr 2024 hatte bereits viele Gläubige überrascht. Nun sorgt der 63-Jährige erneut für Schlagzeilen: Der ehemalige Leiter der Territorialprälatur Caravelí hat geheiratet – noch bevor seine Laisierung offiziell abgeschlossen ist. Sein Schritt löst nicht nur in Peru, sondern auch in Deutschland eine Debatte über das Zölibat und die Zukunft der Kirche aus.
Ein Rücktritt, der Fragen aufwarf
Als Papst Franziskus im Juli 2024 überraschend den Rücktritt von Reinhold Nann annahm, war die Verwunderung groß. Bischöfe treten üblicherweise erst mit 75 Jahren zurück – Nann war zu diesem Zeitpunkt 63. Offiziell begründete der Geistliche seine Entscheidung mit gesundheitlichen Problemen, darunter Stress und Bluthochdruck. Doch schon damals wurde deutlich, dass tiefere Gründe hinter dem Schritt steckten.
Nann, 1960 im badischen Breisach geboren, war seit 2017 Prälat der weitläufigen Territorialprälatur Caravelí im Süden Perus. Seine Aufgabe war anspruchsvoll: rund 137.000 Katholiken, verteilt auf 23 Pfarreien, betreut von nur wenigen Priestern. Schon früher hatte Nann öffentlich darüber gesprochen, dass der Dienst in den entlegenen Andenregionen mit enormen Belastungen verbunden sei.
Von Freiburg nach Südamerika
Reinhold Nann gehört zum Erzbistum Freiburg und war als sogenannter „Fidei-donum“-Priester in den 1990er Jahren nach Peru entsandt worden. Seine seelsorgerische Arbeit in ländlichen Regionen wurde geschätzt – nicht zuletzt wegen seines Engagements für soziale Gerechtigkeit. 2017 ernannte ihn Papst Franziskus schließlich zum Bischof von Caravelí.
Der Übergang vom einfachen Gemeindepfarrer zum Bischof brachte neue Herausforderungen. In Interviews hatte Nann später erklärt, dass sein Bild vom Priestersein „zu idealistisch“ gewesen sei. Die Realität habe ihn eingeholt, sagte er wörtlich. Diese Einsicht deutete bereits auf eine innere Entfremdung vom hierarchischen System der Kirche hin.
Ein ungewöhnlicher Schritt: Heirat ohne Laisierung
Im Herbst 2024 wurde bekannt, dass Nann zivil geheiratet hat – noch bevor seine Entlassung aus dem Klerikerstand offiziell genehmigt war. Formal bleibt er damit Priester und Bischof, auch wenn er keine kirchlichen Ämter mehr ausübt. Die katholische Kirche kennt für solche Fälle den Begriff der „Zölibatsdispens“, also der Freistellung von der Ehelosigkeit. Dieses Verfahren muss vom Papst persönlich genehmigt werden und kann Monate oder gar Jahre dauern.
„Ich habe vieles verloren – aber einen Menschen gewonnen“
In seinem Blog schrieb Nann offen über seine Entscheidung: „Ich habe mein Amt aufgegeben, weil ich einen Menschen gefunden habe, mit dem ich nicht mehr verstecken muss, was ich bin.“ Zugleich räumte er ein, dass er mit seiner Entscheidung vieles verloren habe – darunter Status, Einkommen und Krankenversicherung. Dennoch empfinde er sein neues Leben als ehrlich und frei.
Diese Offenheit wurde von vielen Gläubigen in Peru positiv aufgenommen. Auf der Facebook-Seite der Conferencia Episcopal Peruana teilten zahlreiche Nutzer Worte des Respekts und der Unterstützung. Andere hingegen kritisierten, Nann habe ein schlechtes Beispiel gegeben, indem er vor dem Abschluss der Laisierung heiratete.
Debatte um das Zölibat: Ein altes Thema in neuem Licht
Der Fall Nann fällt in eine Zeit, in der die Diskussion um das Pflichtzölibat weltweit an Fahrt aufnimmt. In mehreren lateinamerikanischen Ländern zeigen Umfragen, dass viele Gläubige eine Lockerung der Regel befürworten. In Chile und den USA sprechen sich rund zwei Drittel der Katholiken dafür aus, Priestern die Ehe zu erlauben. In Peru ist die Mehrheit der Gläubigen jedoch weiterhin skeptisch.
Warum gibt es das Zölibat überhaupt?
Die Frage beschäftigt viele – nicht nur im Internet. In Foren wie Gutefrage wird häufig erklärt, dass das Zölibat ursprünglich eingeführt wurde, um Erbrechtsprobleme und die Vererbung kirchlicher Güter zu verhindern. Erst später entwickelte sich daraus ein moralisches Ideal. Heute gilt es als Symbol der ungeteilten Hingabe an Gott, wird jedoch zunehmend als Belastung für Priester empfunden.
Was passiert, wenn ein Priester das Zölibat bricht?
Kirchenrechtlich droht in solchen Fällen eine Suspendierung oder Laisierung. Der Betroffene verliert seine Stellung, häufig auch seine soziale Absicherung. Gerade im Ausland, wo kirchliche Strukturen schwächer ausgeprägt sind, kann das existenzielle Folgen haben. Auch Nann selbst schrieb, dass sein Schritt „kein leichter“ gewesen sei, aber für ihn der einzige Weg, authentisch zu leben.
Kirchliche und gesellschaftliche Reaktionen
Innerhalb der Kirche gehen die Reaktionen weit auseinander. Während konservative Stimmen den Schritt kritisieren, sehen Reformbefürworter in Nanns Entscheidung einen „ehrlichen Akt der Gewissensfreiheit“. Der Theologe Leonardo Boff, ein prominenter Vertreter der Befreiungstheologie, erklärte jüngst, dass der Zölibat in seiner heutigen Form „mehr Schaden als Nutzen“ anrichte. Er forderte eine Neubewertung dieses Konzepts, insbesondere für Lateinamerika, wo viele Priester in Einsamkeit leben.
Auch der maltesische Erzbischof Charles Scicluna, ein enger Vertrauter des Papstes, plädiert für mehr Offenheit. „Priester sollten heiraten dürfen“, sagte er in einem Interview. „Es ist Zeit, dass wir diese Frage ohne Angst und Ideologie betrachten.“
Ein Schritt mit Symbolwirkung
Nanns Heirat hat daher über die Grenzen Perus hinaus Symbolkraft. Sie steht für eine Bewegung innerhalb der Kirche, die nach Authentizität und Menschlichkeit sucht. Gerade in Südamerika, wo viele Geistliche in prekären Verhältnissen leben, wird seine Entscheidung als Zeichen für mehr Ehrlichkeit gesehen. Einige Beobachter sprechen sogar von einem „stillen Reformakt“ – von unten, nicht von oben.
Die Territorialprälatur Caravelí: Ein Blick auf die Realität vor Ort
Caravelí liegt in der peruanischen Andenregion Ayacucho und umfasst eine riesige Fläche mit verstreuten Gemeinden. Nur wenige Straßen sind asphaltiert, viele Pfarreien sind schwer erreichbar. Nann hatte sich in seiner Amtszeit besonders für den Ausbau sozialer Projekte eingesetzt: Schulen, Gesundheitsstationen und Jugendprogramme wurden unter seiner Leitung erweitert. Die Prälatur gilt als Beispiel für eine Kirche, die unter schwierigen Bedingungen lebendig bleibt.
Herausforderungen des kirchlichen Lebens
Die Realität vieler Priester in Lateinamerika unterscheidet sich deutlich von der in Europa. Sie arbeiten oft allein, über große Distanzen hinweg und ohne die gewohnte Unterstützung einer Diözese. In diesem Umfeld kann die Verpflichtung zum Zölibat als zusätzliche seelische Belastung empfunden werden. Nann selbst sprach von „Abgründen, Tragödien und Lügen“, die er im kirchlichen System erlebt habe.
Was sagen die Gläubigen?
In sozialen Medien zeigt sich ein gemischtes Bild. Viele peruanische Katholiken äußern Verständnis, andere verweisen auf die Pflicht zur Disziplin. Ein Nutzer kommentierte: „Ein Hirte sollte seine Herde nicht verlassen.“ Ein anderer schrieb: „Endlich jemand, der ehrlich ist.“ Diese Spannbreite spiegelt die tiefen Spannungen innerhalb der Kirche wider – zwischen Tradition und Reform, zwischen Hierarchie und Menschlichkeit.
Kirchenrechtliche Einordnung und Bedeutung für die Zukunft
Kirchenrechtlich bleibt Reinhold Nann bis zum Abschluss der Laisierung Priester. Seine zivile Ehe ist aus kirchlicher Sicht nicht anerkannt, auch wenn sie nach peruanischem Recht gültig ist. Sollte der Vatikan seinem Antrag auf Dispens zustimmen, wäre Nann vollständig vom Zölibat entbunden – ein Prozess, der oft Jahre dauert.
Was bedeutet Laisierung genau?
Die Laisierung ist ein formaler Akt, durch den ein Priester in den Laienstand zurückkehrt. Sie beinhaltet neben der Zölibatsdispens auch die Entbindung von priesterlichen Pflichten. Danach darf der Betroffene nicht mehr offiziell Sakramente spenden, wohl aber als Christ in der Gemeinde aktiv sein. Nann betonte, dass er der Kirche weiterhin verbunden bleiben wolle – „aber nicht mehr als Funktionsträger“.
Ein persönlicher Neuanfang – und ein institutionelles Signal
In seinem Blog schreibt Nann regelmäßig über seine neue Lebenssituation. Er nennt sie „eine zweite Berufung“. Trotz der Kritik an der Kirche bleibt seine Verbundenheit spürbar. „Ich liebe die Kirche noch immer“, sagt er, „aber ich glaube, sie braucht mehr Ehrlichkeit und weniger Angst.“
Seine Worte treffen einen Nerv. Immer mehr Gläubige, auch in Deutschland, wünschen sich eine offenere Haltung gegenüber verheirateten Priestern. Die Frage, ob Priester heiraten dürfen sollten, gehört inzwischen zu den meistgesuchten Themen rund um kirchliche Reformen. Das zeigt, wie sehr sich die katholische Welt im Wandel befindet.
Ausblick: Ein Wandel, der Zeit braucht
Der Fall Reinhold Nann wird in Erinnerung bleiben – nicht nur als persönliche Geschichte, sondern als Spiegelbild einer Kirche im Umbruch. Während Rom über die Laisierung entscheidet, geht in Peru das Leben weiter. Nann lebt mit seiner Frau zurückgezogen, engagiert sich aber weiterhin in sozialen Projekten. Seine Entscheidung hat Diskussionen ausgelöst, die weit über die Grenzen seiner ehemaligen Diözese hinausreichen.
Am Ende steht eine Erkenntnis: Die Kirche verändert sich nicht durch Beschlüsse allein, sondern durch Menschen, die den Mut haben, ihren Weg zu gehen – auch wenn er außerhalb der gewohnten Strukturen liegt.





































