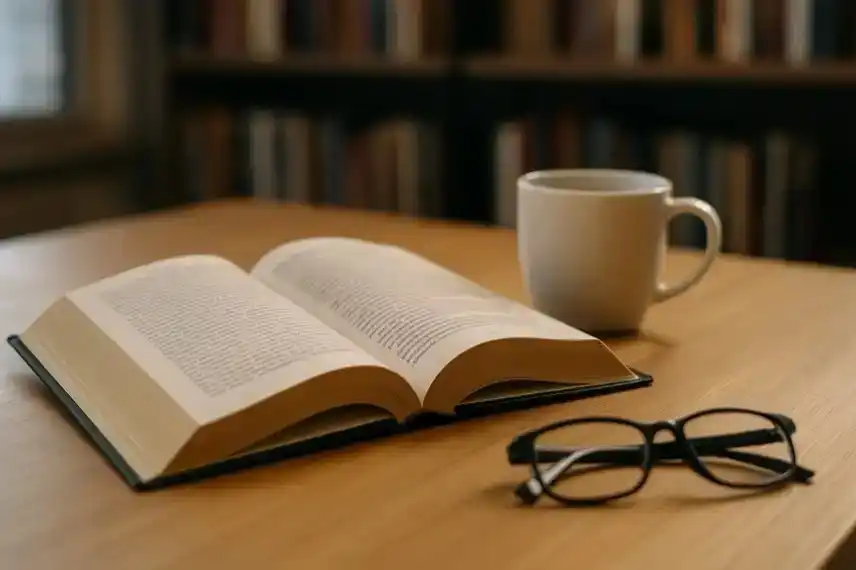Karlsruhe – Der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes nimmt in der Fächerstadt konkrete Formen an. Die Stadtwerke Karlsruhe und die Deutsche Telekom haben eine richtungsweisende Partnerschaft geschlossen, um gemeinsam in den kommenden Jahren gigabitfähige Internetanschlüsse in tausende Haushalte und Betriebe zu bringen. Damit positioniert sich Karlsruhe als Vorreiter einer modernen, digitalen Infrastruktur, die gleichzeitig kommunale Verantwortung und privatwirtschaftliche Kompetenz vereint.
Glasfaserausbau in Karlsruhe: Der Vertrag steht, der Ausbau beginnt
Am 17. Juli 2025 unterzeichneten die Stadtwerke Karlsruhe und die Deutsche Telekom einen Kooperationsvertrag, der den flächendeckenden Ausbau von FTTH-Anschlüssen (Fiber To The Home) in mehreren Stadtteilen vorsieht. Ziel ist es, bereits ab 2026 über 1 000 Haushalte und Unternehmen in Rüppurr und der Nordweststadt mit schnellem Glasfaserinternet zu versorgen. In der Folge sollen nach und nach weitere Stadtteile angeschlossen werden. Das langfristige Ziel: eine nahezu vollständige Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen bis Ende 2029.
Die Aufgaben sind klar verteilt: Die Stadtwerke übernehmen den Ausbau der passiven Netzinfrastruktur – das heißt Tiefbauarbeiten, das Verlegen der Glasfaserkabel und die Instandhaltung. Die Telekom bringt sich beim aktiven Betrieb des Netzes ein, sorgt für moderne Technik, Netzmanagement und vermarktet die Anschlüsse gemeinsam mit Partnern.
Wie funktioniert der Glasfaserausbau in Kooperation?
Das Karlsruher Modell basiert auf einem sogenannten Open-Access-Ansatz. Das bedeutet: Das Netz wird nicht exklusiv durch einen Anbieter betrieben, sondern ist offen für verschiedene Dienstleister. Neben der Telekom und den Stadtwerken Karlsruhe können auch Drittanbieter wie 1&1, Vodafone oder Telefónica ihre Dienste auf dem Netz anbieten.
Für Kundinnen und Kunden hat dieses Modell mehrere Vorteile:
- Sie können zwischen verschiedenen Internetanbietern wählen.
- Es entstehen faire Wettbewerbsbedingungen.
- Die Auslastung des Netzes wird optimiert.
Dieses Modell ist nicht neu, aber in Deutschland noch nicht flächendeckend umgesetzt. Gerade kommunale Partner wie Stadtwerke sind hier wichtige Akteure, weil sie bestehende Infrastrukturen, lokale Kenntnisse und bürgernahen Service in das Projekt einbringen können.
Welche Stadtteile profitieren zuerst vom Ausbau?
In der ersten Phase konzentriert sich der Ausbau auf Rüppurr und die Nordweststadt. Hier sollen bereits im Jahr 2026 die ersten Glasfaseranschlüsse in Betrieb gehen. Bis 2029 soll der Ausbau auf große Teile des Stadtgebiets ausgeweitet werden. Auch die Innenstadt und Stadtteile wie Oberreut sind mittelfristig Teil der Planungen.
Hintergrund: Warum Glasfaser und warum jetzt?
Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s ist Glasfaser der Goldstandard unter den Internetanschlüssen. Während DSL und Kabelnetze an technische Grenzen stoßen – etwa bei steigender Anzahl an Endgeräten im Haushalt oder Homeoffice-Nutzung – bietet Glasfaser stabile und hochleistungsfähige Kapazitäten. Die Nachfrage nach schnellem Internet ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen.
Deutschland hinkte lange Zeit im europäischen Vergleich hinterher. Während Länder wie Schweden und Frankreich frühzeitig auf Multi-Stakeholder-Kooperationen setzten, konzentrierte sich Deutschland auf den Kupferleitungsbestand. Erst durch neue politische Rahmenbedingungen wie das Telekommunikationsgesetz von 2021 und die Gigabitstrategie von 2022 hat sich die Lage verändert.
Heute setzen immer mehr Städte auf Kooperationen zwischen Stadtwerken und Telekommunikationsunternehmen – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn der FTTH-Ausbau ist kostenintensiv: Schätzungen gehen bundesweit von bis zu 80 Mrd. € aus.
Welche Rolle spielen die Stadtwerke Karlsruhe in der Kooperation?
Die Stadtwerke bringen ihre lokale Expertise ein und sorgen für die technische Umsetzung vor Ort. Durch Synergien mit anderen Infrastrukturbereichen – etwa dem gleichzeitigen Ausbau von Strom- oder Wärmenetzen – können Bauarbeiten gebündelt und Kosten gesenkt werden. Außerdem soll so die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner reduziert werden.
Für die Stadtwerke ist das Projekt ein strategischer Schritt in Richtung digitaler Daseinsvorsorge. „Wir wollen nicht nur Strom und Wasser liefern, sondern auch digitale Infrastruktur bereitstellen – als Teil unserer Verantwortung für die Zukunft der Stadt“, betonte ein Sprecher der Stadtwerke im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.
Wie steht die Telekom zur Kooperation mit kommunalen Partnern?
Für die Telekom sind solche Kooperationen Teil einer übergeordneten Strategie: Bis 2030 sollen bundesweit 25 Millionen Haushalte mit FTTH versorgt werden. Allein im Jahr 2023 stammte jeder vierte neu gebaute Anschluss aus Kooperationen mit kommunalen Partnern.
„Gemeinsam mit Stadtwerken und regionalen Anbietern erreichen wir mehr Bürger schneller und effizienter“, heißt es aus der Konzernzentrale in Bonn. Kooperationen wie in Karlsruhe werden als Blaupause für andere Städte betrachtet – gerade im Hinblick auf faire Marktbedingungen und offene Netzstrukturen.
Wie funktioniert der sogenannte Open-Access-Ansatz?
Beim Open-Access-Modell werden Infrastruktur und Dienste voneinander getrennt. Die Stadtwerke bauen und besitzen das Netz, die Telekom und andere Anbieter nutzen es gegen Entgelt. Dieses Modell senkt die Markteintrittsbarrieren für kleinere Anbieter und verhindert monopolistische Strukturen. Auch für Endkundinnen und -kunden entsteht so ein transparenter, wettbewerbsfähiger Markt.
Statistiken: Der Glasfaserausbau in Zahlen
| Kriterium | Wert (Stand 2025) |
|---|---|
| FTTH-Haushalte in Deutschland (Homes Passed) | 21,3 Millionen |
| Jährliches Wachstum (2021–2024) | 33 % |
| Telekom-Anteil an FTTH-Haushalten | 48 % |
| Geplante Anschlüsse durch Kooperation Karlsruhe | 1 000+ ab 2026 |
| Zielmarke Deutschland (bis 2030) | Nahezu vollständige FTTH-Versorgung |
Kritische Stimmen zum Glasfaserausbau
Während der Ausbau in Karlsruhe überwiegend begrüßt wird, gibt es auch kritische Stimmen – insbesondere zum Infrastrukturwettbewerb. Der sogenannte Doppelausbau – also parallele Netze verschiedener Anbieter – wird von einigen als Ressourcenverschwendung kritisiert. Tatsächlich wird durch überlappende Planungen der Tiefbau teurer und ineffizienter.
Gleichzeitig betonen Experten wie der Wettbewerbsrechtler Prof. Körber, dass Infrastrukturwettbewerb auch Innovation und technische Weiterentwicklung fördern kann. Wichtig sei jedoch eine ausgewogene Regulierung, die faire Bedingungen für alle Beteiligten schaffe und Monopole vermeide.
Wie reagieren Politik und Bürger auf das Projekt?
Die Stadt Karlsruhe unterstützt das Vorhaben aktiv. Informationsveranstaltungen, Infomobile und digitale Tools sollen die Bürgerinnen und Bürger aufklären und beteiligen. Insbesondere die Möglichkeit, sich frühzeitig registrieren zu lassen, ermöglicht eine zielgerichtete Planung des Ausbaus.
Politisch ist der Glasfaserausbau ein zentrales Element der Smart-City-Strategie der Stadt. Die kommunale Verwaltung sieht in digitalen Netzen nicht nur wirtschaftliches Potenzial, sondern auch eine Voraussetzung für soziale Teilhabe und moderne Bildung.
Ein Blick in die Zukunft: Digitalisierung made in Karlsruhe
Die Kooperation zwischen den Stadtwerken Karlsruhe und der Telekom steht beispielhaft für eine moderne, verantwortungsvolle Infrastrukturpolitik. Durch die Kombination aus technischer Kompetenz, wirtschaftlicher Effizienz und bürgernaher Kommunikation entsteht ein Projekt, das sowohl lokal als auch bundesweit Strahlkraft besitzt.
Mit dem nun gestarteten Ausbau leistet Karlsruhe einen aktiven Beitrag zur digitalen Transformation Deutschlands. Es zeigt sich: Der Weg zu flächendeckendem Highspeed-Internet führt nicht nur über Konzerne oder den Bund – sondern auch über Partnerschaften vor Ort. Das Projekt vereint regionale Stärke mit überregionaler Technologie – ein Modell mit Zukunftspotenzial.