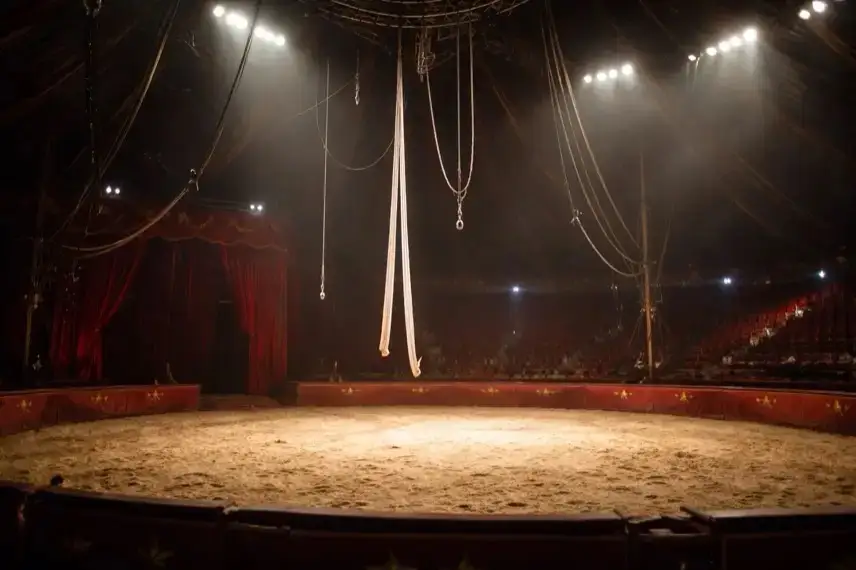Stuttgart – Ein ungewöhnlicher Vorfall im Osten der Landeshauptstadt sorgt derzeit für Diskussionen: Zwei unbekannte Tiere, gesichtet in der Dämmerung, wurden von einer Anwohnerin als Marderhunde identifiziert. Während Experten über die tatsächliche Art der Tiere uneins sind, werfen Sichtung und Reaktion der Behörden viele Fragen zur Präsenz, Gefährlichkeit und Bejagung des Marderhundes in Baden-Württemberg auf.
Ein nächtliches Pärchen in Gaisburg?
Die Szene spielte sich in Stuttgart-Gaisburg ab. Eine Anwohnerin meldete der Stadtverwaltung zwei Tiere, die „auffallend flauschig und niedrig gebaut“ gewesen seien – und an Marderhunde erinnerten. Die Tiere liefen gegen Abend über einen Gehweg nahe der Wagenburgstraße. Was zunächst nach einer kuriosen Beobachtung klang, entwickelte sich schnell zu einem Diskussionsthema zwischen Bürgern, Behörden und Umweltorganisationen.
Die Stadt selbst gab nach Sichtung der Meldung zunächst Entwarnung: „Es liegen keine konkreten Hinweise oder Nachweise auf ein Marderhund-Vorkommen in Stuttgart vor“, heißt es von offizieller Seite. Spuren, Kot oder weitere Sichtungen fehlten – man gehe eher von einer Verwechslung mit Waschbären oder Dachsen aus.
Was sind Marderhunde überhaupt?
Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) stammt ursprünglich aus Ostasien. Eingeführt wurde er in Europa ursprünglich für die Pelzindustrie – besonders während der 1950er- und 1960er-Jahre. Er gilt heute als sogenannter Neozoon – also als gebietsfremde Art, die sich hier etabliert hat. Besonders häufig ist er in den östlichen Bundesländern Deutschlands wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Sachsen zu finden.
Marderhunde sind scheue, dämmerungs- und nachtaktive Allesfresser. Sie leben meist in Paaren oder einzeln und bevorzugen bewaldete Gebiete sowie Stadtränder mit Deckung und Nahrungsvielfalt. Ein erwachsenes Tier erreicht etwa eine Körperlänge von 50–68 cm, bei einer Schulterhöhe von rund 30 cm.
Warum gelten Marderhunde als invasive Art?
Auf europäischer Ebene wurde der Marderhund 2017 als invasive Art eingestuft. Seit 2019 ist es laut EU-Verordnung verboten, Marderhunde zu züchten, zu halten oder gezielt freizusetzen. Diese strikte Regelung begründet sich mit der ökologischen Gefahr: Marderhunde verdrängen in manchen Regionen heimische Arten, da sie ein sehr flexibles Nahrungsspektrum aufweisen und keine natürlichen Feinde in Europa haben.
Seltenheit in Baden-Württemberg – aber nicht ausgeschlossen
Laut den Erfassungen des Landesjagdverbands und des Wildtierportals Baden-Württemberg wurden im Jagdjahr 2019/20 lediglich 30 Marderhunde im gesamten Bundesland erlegt. Insgesamt wurden in den letzten zehn Jahren gerade einmal 62 Tiere erfasst, davon 50 erlegt und 12 überfahren. Die Tierart bleibt also eine Ausnahme – auch wenn gelegentliche Einzelnachweise vorliegen.
Ein Vertreter des NABU Stuttgart kommentierte: „Es sind schon Marderhunde aus Stuttgart gemeldet worden. Ein dauerhaftes Vorkommen ist aber nicht belegt.“ Das zeigt: Komplett ausgeschlossen ist die Sichtung nicht – auch wenn sie mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verwechslung sein könnte.
Wie häufig werden Marderhunde in Baden-Württemberg bejagt?
Die Datenlage zur Bejagung ist eindeutig: Marderhunde spielen in der Jagdstatistik Baden-Württembergs eine marginale Rolle. Bundesweit sieht das anders aus. Im Jagdjahr 2020/21 wurden über 33.000 Marderhunde erlegt – der Großteil davon in den östlichen Bundesländern.
Jagdrecht und gesetzliche Lage
In Baden-Württemberg ist der Marderhund eine jagdbare Art mit festgelegten Jagdzeiten. Die Hauptjagdzeit liegt zwischen dem 1. Juli und dem 15. Februar. Jungtiere dürfen sogar ganzjährig gejagt werden, sofern die allgemeine Schonzeit nicht greift (16. Februar bis 15. April). Damit ist der rechtliche Rahmen klar definiert – zumal der Marderhund als invasive Art ohne Schutzstatus gilt.
Ab wann darf man Marderhunde in Baden-Württemberg jagen?
Die Jagd ist – wie oben beschrieben – an die gesetzliche Jagdzeit gebunden. Eine Ausnahme besteht bei Jungtieren außerhalb der allgemeinen Schonzeit. Das bedeutet: Schon im Sommer kann eine Bejagung stattfinden, sofern ein begründeter Anlass oder Sichtung vorliegt.
Krankheitsüberträger oder harmlose Nachtschwärmer?
Ein weiteres Argument für die Jagd ist die potenzielle Rolle des Marderhundes als Krankheitsüberträger. Studien zeigen, dass Marderhunde an der hochansteckenden Sarkoptes-Räude leiden können – einer parasitären Hautkrankheit, die auch auf Haustiere übertragbar ist. Zudem gelten sie als mögliche Träger anderer Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragbar sind.
Können Marderhunde Krankheiten wie Räude verbreiten?
Ja – wissenschaftlich belegt ist die Übertragung von Sarkoptes-Räude durch wild lebende Marderhunde, etwa in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus weisen Studien auf ein Reservoir potenzieller Infektionserreger im Marderhund hin. Eine Forschergruppe fand 2025 Hinweise darauf, dass Marderhunde zur Verbreitung bestimmter Erreger beitragen könnten – eine Gefahr nicht nur für Wildtiere, sondern auch für Menschen und Haustiere.
Ein globaler Gesundheitsaspekt: COVID-19 und Wildtiere
Ein bislang kaum diskutierter Aspekt ist die mögliche Rolle des Marderhundes als Zwischenwirt für das Coronavirus SARS-CoV-2. Auf dem Huanan-Seafood-Markt in Wuhan, wo erste Infektionen festgestellt wurden, sollen Marderhunde in unmittelbarer Nähe zum Menschen gehalten worden sein. Diese Beobachtungen machten sie zu einem der wahrscheinlichen Zwischenwirte im Rahmen der Pandemieentwicklung – auch wenn die exakte Rolle weiterhin erforscht wird.
Versteckter Handel mit Marderhund-Fellen
Ein besonders kritischer Blick gilt dem internationalen Fellhandel. Dort werden Marderhunde oftmals unter verharmlosenden oder irreführenden Namen geführt – beispielsweise als „Seefuchs“, „Finnraccoon“ oder „Tanuki“. Diese Handelsbezeichnungen verschleiern die tatsächliche Tierart – und führen zu Verbrauchertäuschung. Gerade in der Textilindustrie – etwa bei Jacken mit Pelzkragen – ist diese Praxis noch immer weit verbreitet.
Online-Debatten und Social-Media-Diskussionen
In sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook, aber auch in Jagd- und Naturschutzforen, polarisiert das Thema Marderhund regelmäßig. Während einige Nutzer die „Verteufelung“ des Tieres kritisieren, fordern andere eine konsequente Bejagung zum Schutz heimischer Arten.
Ein Forenbeitrag bringt es auf den Punkt: „Die Kommunikation über sogenannte invasive Arten ist zu oft von Angst und Halbwahrheiten geprägt. Was wir brauchen, ist wissenschaftlich fundierte Aufklärung.“ Der Satz zeigt exemplarisch, wie emotional das Thema in Teilen der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Warum gelten Marderhunde als Gefahr für heimische Arten?
Aufgrund ihrer Allesfresserei und hohen Anpassungsfähigkeit können Marderhunde in sensiblen Ökosystemen eine Bedrohung darstellen. Sie konkurrieren mit heimischen Arten um Nahrung und Lebensraum. In Ballungsräumen oder Gebieten mit hohem Artenreichtum können sie das ökologische Gleichgewicht stören – ein Argument, das von Befürwortern der Bejagung häufig genannt wird.
Was sagt die Forschung zur Verbreitung?
Studien aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen: Marderhunde bevorzugen strukturreiche Lebensräume mit vielen Deckungsmöglichkeiten – etwa Uferzonen, Wälder, Brachen oder Landwirtschaftsflächen. Auch wenn die Ergebnisse nicht direkt auf Baden-Württemberg übertragbar sind, geben sie Hinweise darauf, welche Gebiete für die Art attraktiv sein könnten – insbesondere in der Nähe von Flussläufen und Waldrändern rund um Stuttgart.
Öffentlichkeitsarbeit und Mediennarrative
Interessant ist auch, wie das Thema kommuniziert wird. Jagdverbände setzen seit Jahren verstärkt auf Social Media, um ihre Position zur Bejagung invasiver Arten zu verbreiten. Dafür erhalten sie teilweise sogar staatliche Zuschüsse. Gleichzeitig wird Kritik laut, dass bestimmte Narrative übertrieben und wenig differenziert seien – etwa wenn Marderhunde pauschal als Gefahr dargestellt werden, obwohl sie in manchen Regionen kaum vorkommen.
Ein Tier zwischen Faszination, Gefahr und Missverständnis
Ob die Tiere, die in Stuttgart-Ost gesehen wurden, tatsächlich Marderhunde waren, wird wohl offen bleiben. Die Stadtverwaltung bleibt vorsichtig, Fachleute mahnen zur Differenzierung – und Naturschützer wie Jäger diskutieren über Umgang, Bejagung und Schutz.
Was jedoch klar ist: Der Marderhund ist längst nicht nur ein biologisches Phänomen, sondern ein gesellschaftliches. Er steht sinnbildlich für die Herausforderungen im Umgang mit neuen Wildtierarten in unseren Städten – und für die Frage, wie wir in einer zunehmend urbanisierten Welt mit Natur umgehen wollen. Die Debatte wird weitergehen. Vielleicht nicht jeden Tag sichtbar – aber immer unter der Oberfläche unserer Wälder und Parks.