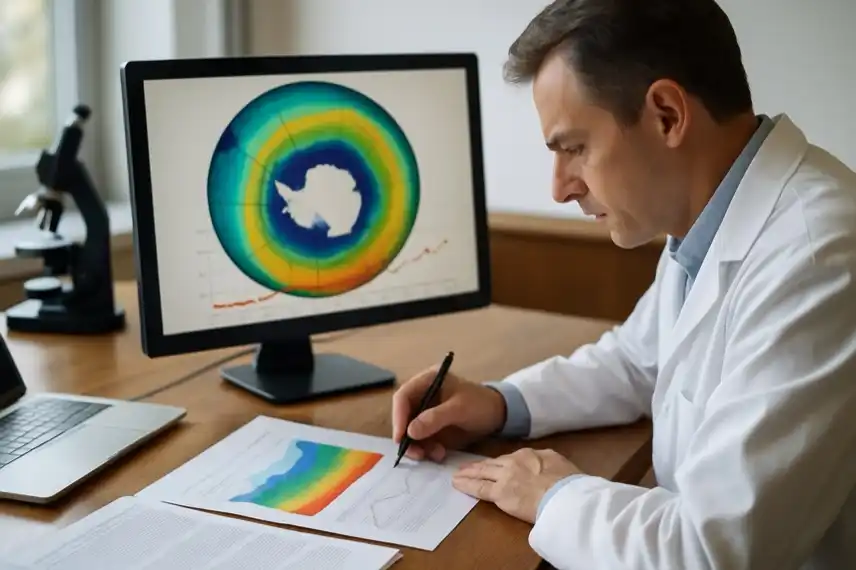Rostock-Hinrichsdorf – Die Lage ist angespannt: Nach intensiven Regenfällen steht das Regenrückhaltebecken im Rostocker Stadtteil Hinrichsdorf kurz vor dem Überlaufen. Die Reserve beträgt nur noch wenige Zentimeter – eine Überflutung angrenzender Wohn- und Gewerbegebiete droht. Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen mit Hochleistungspumpen das Schlimmste zu verhindern.
Ein Rückhaltebecken am Limit – und was das bedeutet
Rückhaltebecken sind essenzielle Bestandteile moderner Stadtplanung, um die Entwässerung bei starken Regenfällen zu kontrollieren. Sie puffern Wassermassen, die innerhalb kurzer Zeit durch Starkregen auf versiegelte Flächen treffen, und geben diese reguliert an Flüsse, Bäche oder das Kanalsystem ab. Doch wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist – wie aktuell in Rostock-Hinrichsdorf – wird aus einer Schutzmaßnahme schnell ein Risiko.
Am frühen Morgen des 1. August 2025 wurde der kritische Punkt nahezu erreicht: Nur noch wenige Zentimeter trennten das Oberflächenwasser vom Rand des Rückhaltebeckens. Ein Überlauf hätte unmittelbare Konsequenzen für das angrenzende Wohngebiet – eine Flutung von Kellern, Straßen und möglicherweise auch Wohnräumen wäre die Folge.
Wie kritisch ist eine Restkapazität von wenigen Zentimetern im Rückhaltebecken?
Extrem kritisch – denn Rückhaltebecken funktionieren nur innerhalb ihrer Bemessungsgrenzen. Fehlen nur wenige Zentimeter bis zur Überlaufkante, reichen bereits geringe weitere Regenmengen, um die Schwelle zu überschreiten. Bei gleichzeitigem Verstopfen des Abflusses und nachlaufenden Wassermengen – wie es in Hinrichsdorf der Fall ist – bleibt keine Zeit für Verzögerungen.
Starkregen als zunehmendes Risiko – auch in Norddeutschland
Starkregenereignisse nehmen in Deutschland seit Jahren zu. Auch wenn die Gefahr von Hochwasser typischerweise mit Flüssen wie dem Rhein oder der Elbe assoziiert wird, sind es zunehmend innerstädtische Rückhalteanlagen, die überfordert werden. Der Klimawandel trägt durch vermehrte Starkregenereignisse und intensivere Wetterlagen entscheidend dazu bei.
Laut Studien entstanden zwischen 2000 und 2017 allein durch Starkregen Schäden in Höhe von rund 6,7 Milliarden Euro. Häufig treten die Schäden lokal begrenzt auf, betreffen aber Tausende Privathaushalte und Unternehmen. Die tatsächliche Gefahr wird oft unterschätzt – bis es zu spät ist.
Wann kann ein Rückhaltebecken überlaufen und ein Wohngebiet gefährden?
Ein Rückhaltebecken läuft über, wenn die Niederschlagsmenge das Speichervermögen übersteigt – besonders gefährlich wird es, wenn gleichzeitig der Abfluss durch Sediment, Laub oder technische Defekte verstopft ist. Regenwasser staut sich dann im Becken, während weitere Mengen aus dem Kanalnetz oder von versiegelten Flächen zulaufen.
Die Situation in Hinrichsdorf: Feuerwehr im Dauereinsatz
Im Ortsteil Hinrichsdorf, einem eher dünn besiedelten Bereich mit nur etwa 200 Einwohnern, ist das Rückhaltebecken ein zentrales Entwässerungselement. Seit den Starkregenfällen der letzten Tage arbeiten Einsatzkräfte rund um die Uhr daran, die Anlage unter Kontrolle zu halten. Unterstützt wird die Feuerwehr von Katastrophenschutzeinheiten des Landes sowie vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.
Erstmals kam in Mecklenburg-Vorpommern bei einer Hochwasserlage das mobile Wasserfördersystem des Landes zum Einsatz. Dieses war bisher vor allem bei Waldbränden genutzt worden – nun zeigt sich seine technische Flexibilität auch in urbaner Krisenlage.
Welche Maßnahmen ergreifen Behörden, wenn ein Rückhaltebecken droht überzulaufen?
Die typischen Maßnahmen umfassen:
- Aktivierung des Katastrophenschutzes
- Einrichtung mobiler Hochleistungspumpen
- Räumung verstopfter Abflüsse und Kanäle
- Warnungen an die Bevölkerung über Medien und Apps
- Eventuelle Evakuierungen von besonders gefährdeten Haushalten
Innenminister Christian Pegel betonte die Dringlichkeit: „Wir müssen jetzt alles daransetzen, dass die Kapazitäten des Rückhaltebeckens stabil bleiben. Die Situation wird eng beobachtet.“
Versagen durch Verstopfung – eine unterschätzte Gefahr
In Hinrichsdorf ist der Ablauf des Beckens teilweise blockiert. Durch den Rückstau staut sich das Wasser weiter, obwohl es an sich abfließen sollte. Gerade bei urbanen Rückhaltebecken ist die regelmäßige Wartung essenziell – doch nicht immer gelingt dies flächendeckend.
Kann verstopfter Abfluss wirklich eine Überflutung auslösen?
Ja – denn bei blockierten Abläufen wirkt das Rückhaltebecken wie eine überfüllte Badewanne ohne Abfluss. Selbst wenn Regen aufhört, laufen aus dem Kanalsystem weiterhin Restwassermengen nach. Innerhalb kurzer Zeit ist die restliche Reserve verbraucht.
Widerstandsfähige Städte: Schwammstadt als Lösungsansatz
Die Diskussion um klimaresiliente Städte wird angesichts solcher Ereignisse wieder lauter. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das sogenannte Schwammstadt-Prinzip. Es sieht vor, dass Städte wie ein Schwamm Wasser aufnehmen, speichern und zeitverzögert abgeben – z. B. durch:
- Begrünte Dächer und Fassaden
- Versickerungsfähige Wege und Plätze
- Regenwasser-Mulden und Retentionsflächen
- Dezentrale Regenwasserspeicherung
Solche Maßnahmen entlasten Rückhaltebecken, senken die Abflussgeschwindigkeit und bieten auch bei Dürrezeiten ökologische Vorteile.
Gibt es alternative Stadtplanungsstrategien, um solche Überflutungen zu vermeiden?
Ja – neben dem Schwammstadt-Konzept gibt es Maßnahmen wie Rigolen, Rückhaltezisternen oder Rückflussverhinderer in Häusern. Entscheidend ist dabei, dass Städte Regenwasser nicht nur ableiten, sondern intelligent managen.
Strukturelle Schwächen im Risikomanagement
Die Ereignisse in Rostock-Hinrichsdorf werfen auch ein Schlaglicht auf bestehende Defizite. Zwar existieren vielerorts Hochwassergefahrenkarten oder kommunale Starkregenpläne – doch deren Umsetzung ist oft fragmentiert. Besonders kleinere Städte und Gemeinden sind strukturell und finanziell unterversorgt, wenn es um Wartung, Modernisierung und Monitoring technischer Anlagen geht.
Hinzu kommt: Die rechtlichen Standards für Rückhaltebecken variieren stark, je nach Bundesland und Baujahr. Einheitliche Vorgaben zur Inspektion, Kontrolle oder Erneuerung fehlen vielerorts. Diese Lücke wird bei zunehmender Wetterextremität zur Sicherheitslücke.
Schadenspotenzial nicht nur für Privathaushalte
Der Stadtteil Hinrichsdorf ist nicht nur Wohngebiet, sondern umfasst auch Gewerbeeinheiten. Eine Flutung würde daher neben privatem Eigentum auch wirtschaftliche Strukturen treffen – Lieferketten könnten unterbrochen, Maschinen beschädigt, Betriebsabläufe gestört werden.
Wie häufig versagen Rückhaltebecken bei extremen Starkregen?
Je nach Region kommt es bei starkem Regen 30 bis 40 Mal pro Jahr zu einer Auslastung von Rückhaltebecken. Bei Extremwetterlagen – wie in den Jahren 2021 und 2023 – wurde diese Zahl regional weit übertroffen. Besonders gefährdet sind Anlagen, deren Abfluss unzureichend kontrolliert wird oder die keine automatische Wasserstandserkennung besitzen.
Warnsignal für die Zukunft
Die Entwicklungen in Rostock-Hinrichsdorf sind ein weiteres Beispiel dafür, wie verwundbar urbane Infrastrukturen gegenüber Extremwetter geworden sind. Wenn Rückhaltebecken – einst als Schutzmaßnahme gedacht – selbst zum Risiko werden, muss dringend umgedacht werden. Stadtplanung, Wartung und Klimaanpassung dürfen keine optionalen Disziplinen mehr sein.
Der Fall zeigt auch: Es ist nicht die Wassermenge allein, die entscheidet – sondern das Zusammenspiel aus Technik, Vorsorge und Reaktionsfähigkeit. Nur wenn alle drei Elemente ineinandergreifen, lassen sich Katastrophen vermeiden. Für Hinrichsdorf bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen rechtzeitig greifen – und dass die wenigen Zentimeter Reserve nicht das Ende der Schutzlinie markieren.