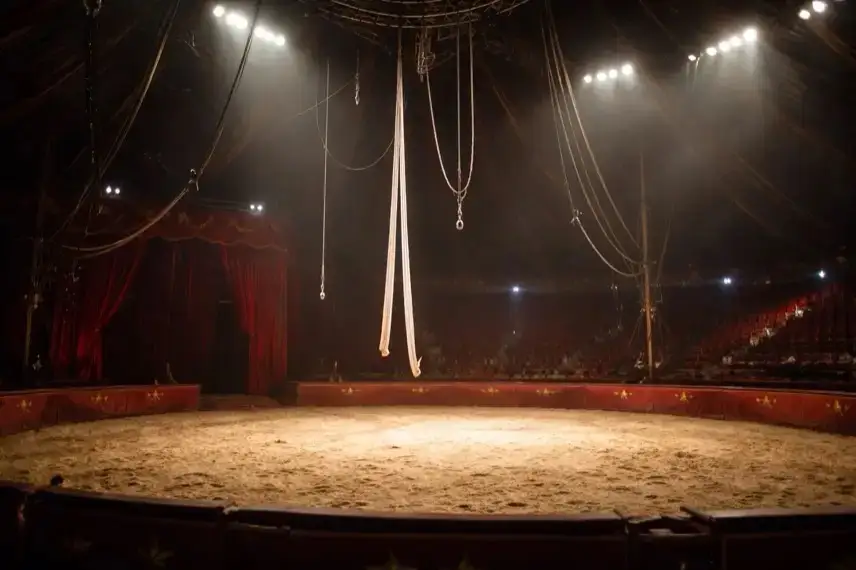Stuttgart – Der Fall Ramzi Awat Nabi erschüttert derzeit nicht nur die baden-württembergische Landeshauptstadt, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Abschiebepraxis in Deutschland. Trotz eines vorbildlichen Integrationsweges, gültigem Pass und laufendem Studium wurde der 23-jährige Student kürzlich in den Irak abgeschoben. Was steckt hinter der Entscheidung der Behörden – und was bedeutet das für ähnlich gelagerte Fälle?
Ein Einser-Abiturient wird abgeschoben
Ramzi Awat Nabi lebte rund sieben Jahre in Deutschland, er absolvierte sein Abitur mit der Note 1,5 und befand sich zum Zeitpunkt seiner Abschiebung kurz vor seinem Bachelorabschluss in Gebäude- und Energietechnik. Laut Freunden und Unterstützern galt er als Paradebeispiel für gelungene Integration: sprachlich versiert, bildungsorientiert und gesellschaftlich engagiert – unter anderem innerhalb der kurdischen Studierendengemeinschaft in Stuttgart.
Umso größer war der Schock, als am 6. August 2025 in den frühen Morgenstunden Polizeibeamte an der Tür seines Studentenwohnheims in Stuttgart-Vaihingen klingelten und ihn zur Abschiebung abholten. Seine Kommilitoninnen und Kommilitonen erfuhren erst im Nachhinein davon. Die Reaktionen reichten von Fassungslosigkeit bis Wut.
Behördliche Begründung: Zweifel an der Identität
Doch wie konnte es zu dieser Abschiebung kommen, obwohl Ramzi im Besitz eines gültigen irakischen Reisepasses war? Diese Frage bewegt viele. Die Antwort der Behörden: Es habe über Jahre hinweg erhebliche Zweifel an seiner Identität gegeben. Bei der Einreise seien gefälschte Papiere verwendet worden, was die Ausländerbehörde dazu veranlasste, eine Aufenthaltserlaubnis zu verweigern – trotz vorgelegten Dokuments vom irakischen Konsulat.
„Die Identität konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, und der Reisepass wurde ohne nachvollziehbare Grundlage ausgestellt“, heißt es aus dem zuständigen Amt. Mehrfach wurde Ramzi aufgefordert, entsprechende Nachweise vom Konsulat zu erbringen. Diese blieben laut Stadtverwaltung aus. Eine Aufenthaltserlaubnis sei damit rechtlich nicht zulässig gewesen – eine Einschätzung, die viele Beobachter als äußerst formalistisch und unverhältnismäßig empfinden.
Integration schützt nicht vor Abschiebung
Dass die Abschiebung eines gut integrierten jungen Menschen keine Ausnahme ist, zeigt die aktuelle Entwicklung in der deutschen Abschiebepraxis. Allein in Baden-Württemberg wurden im ersten Halbjahr 2025 über 1.800 Menschen abgeschoben – bundesweit waren es mehr als 11.800. Ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
| Region | Abschiebungen (Jan–Jun 2024) | Abschiebungen (Jan–Jun 2025) |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ca. 1.370 | 1.841 |
| Deutschland gesamt | 9.465 | 11.807 |
Auf die Frage „Warum wurde Ramzi Awat Nabi trotz gültigem Reisepass abgeschoben?“ antworten die Behörden mit dem Hinweis auf fehlende Authentizität und unklare Herkunftsdokumente. Kritiker sehen hingegen eine systematische Tendenz, besonders leicht auffindbare und greifbare Personen abzuschieben – unabhängig von Integrationsgrad oder Lebensperspektive.
Kritik von Anwälten und Politikern
Ramzis Anwalt bezeichnete die Abschiebung als „überhastet und voreilig“. Der junge Mann habe sich kooperativ verhalten und versucht, seine Identität durch das Konsulat bestätigen zu lassen. Eine Duldung oder zumindest ein erneuter Prüfungsanlauf wäre laut Verteidigung rechtlich möglich gewesen. Der Anwalt kritisiert, dass offenbar die Umsetzbarkeit – also Wohnort und Erreichbarkeit – bei der Auswahl von Abschiebekandidaten eine größere Rolle spiele als individuelle Rechtssicherheit.
Auch aus der Politik kam scharfe Kritik. Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano (DIE LINKE) sprach von politischer Willkür und warf der Stuttgarter Ausländerbehörde vor, eine „systematische Ablehnungskultur“ zu betreiben. Seiner Ansicht nach hätte man Ramzi dauerhaft in Deutschland halten müssen – nicht nur aus humanitärer Sicht, sondern auch im Sinne einer nachhaltigen Integrationspolitik.
Zivilgesellschaft protestiert: „Holt Ramzi zurück!“
In den Tagen nach der Abschiebung organisierten Freunde, Kommilitoninnen und Unterstützer mehrere Protestkundgebungen in Stuttgart. Besonders medienwirksam: eine Demonstration am Rotebühlplatz. Parallel wurde auf Change.org eine Petition mit dem Titel „Holt Ramzi Awat Nabi zurück!“ ins Leben gerufen, die innerhalb weniger Tage über 2.600 Unterschriften verzeichnete.
„Ramzi hat sich in unsere Gesellschaft eingebracht, war ein Vorbild für viele und wurde dennoch mitten in der Nacht wie ein Krimineller abgeholt“, so eine der Initiatorinnen der Petition. Die Protestbewegung betont insbesondere Ramzis Rolle als Kulturvermittler in der kurdischen Community. Sein Engagement in der politischen Aufklärungsarbeit und sein Beitrag zu interkulturellem Austausch würden nun zunichte gemacht.
Rechtliche Lage und mögliche Rückkehr
Doch welche Chancen bestehen für Ramzi, nach Deutschland zurückzukehren? Die Ausreise ist mit einer Einreisesperre von drei Jahren verbunden – ein Standard bei zwangsweisen Abschiebungen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Sperre verkürzen zu lassen, etwa über einen Härtefallantrag oder ein gezieltes Visumverfahren.
Auf die häufig gestellte Nutzerfrage „Welche rechtlichen Optionen hat Ramzi jetzt?“ lautet die nüchterne Antwort: Er könnte ein Studienvisum beantragen und parallel die Aufhebung der Einreisesperre betreiben. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch von seiner Bereitschaft ab, die Abschiebekosten zu übernehmen, sowie vom Willen der deutschen Behörden, den Fall neu zu bewerten.
Öffentlicher Druck und symbolische Bedeutung
Der Fall hat mittlerweile Symbolcharakter angenommen. Es geht längst nicht mehr nur um eine Einzelperson, sondern um die generelle Frage: „Wie hat die Stuttgarter Community auf die Abschiebung reagiert?“ Die Antwort zeigt sich in der breiten Unterstützung, in politischen Anträgen zur Überprüfung des Verfahrens und in einer zunehmend kritischen öffentlichen Debatte über die Rolle lokaler Ausländerbehörden.
Insbesondere die kurdische Community sieht sich durch diesen Vorfall erneut stigmatisiert. In sozialen Medien ist von einem „politisch motivierten Signal“ die Rede. Abschiebungen von gut integrierten, jungen Kurden häuften sich, so die Wahrnehmung in Aktivistenkreisen. Auch deshalb sei der Fall Ramzi Awat Nabi kein Einzelfall, sondern Teil eines strukturellen Problems.
Ungeklärte Fragen und Widersprüche
Besonders brisant: Laut der Petition habe Ramzi zum Zeitpunkt der Festnahme eine vorläufige Bescheinigung zur Aussetzung der Abschiebung vorlegen können. Dennoch wurde er abgeschoben. Der genaue Ablauf, wer wann welche Dokumente kannte und wie die Entscheidung letztlich getroffen wurde, bleibt unklar. Ein Versäumnis in der behördlichen Kommunikation könnte hier weitreichende Folgen gehabt haben.
Auch die Frage „Was sagt der Anwalt zu dem Vorgehen der Behörden?“ zeigt, wie brisant der Fall ist. Der Vorwurf, dass besonders „einfach greifbare“ Personen wie Ramzi als statistisches Mittel zur Erhöhung der Abschiebezahlen missbraucht werden, ist ein schwerwiegender. Eine unabhängige Untersuchung des Ablaufs wird zunehmend gefordert.
Zwischen Recht und Gerechtigkeit
Der Fall Ramzi Awat Nabi zeigt, wie stark sich rechtliche Regelungen und gesellschaftliches Empfinden voneinander entfernen können. Während die Behörden auf Paragraphen und formale Abläufe pochen, fordern viele Menschen eine stärkere Gewichtung humanitärer Faktoren und individueller Lebensverläufe. Die Frage, ob das Recht immer auch gerecht ist, steht im Zentrum der öffentlichen Debatte.
Für Stuttgart bedeutet der Fall eine ernsthafte Prüfung der eigenen Integrationspolitik. Der sogenannte „Stuttgarter Weg“, der Integration mit Augenmaß und Menschlichkeit verbinden soll, steht auf dem Prüfstand. Wird ein solcher Weg durch bürokratische Starrheit konterkariert, verliert er seine Glaubwürdigkeit.
Ob Ramzi jemals zurückkehren kann, bleibt offen. Klar ist aber: Sein Fall wird nicht vergessen werden. Er ist zu einem Prüfstein geworden – für Behörden, für Politik und für die Gesellschaft als Ganzes.