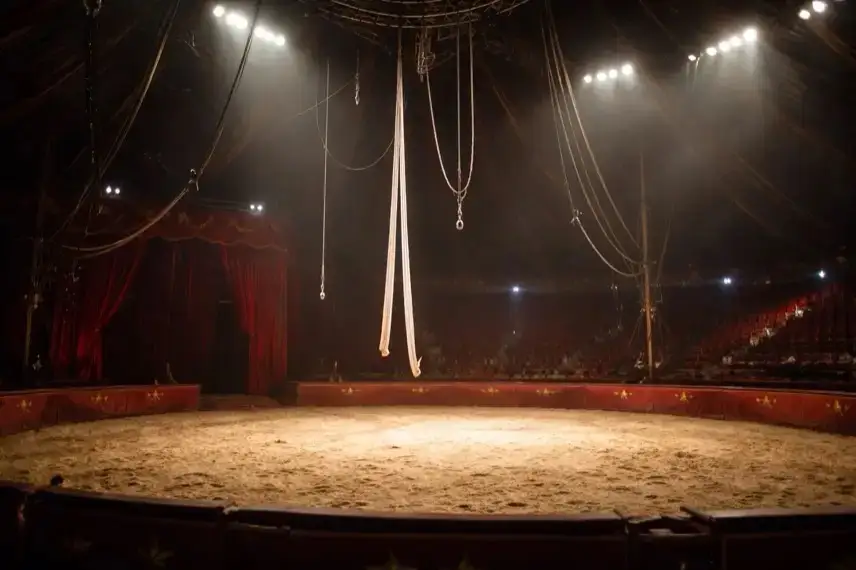Stuttgart – Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2035 soll Stuttgart klimaneutral werden. Der Weg dorthin ist gepflastert mit ambitionierten Plänen, Herausforderungen und vielen offenen Fragen. Während die Stadtverwaltung, Unternehmen und Bürgerschaft an Lösungen arbeiten, steht eines fest: Die nächsten Jahre werden für Stuttgart entscheidend sein.
Der Klima-Fahrplan 2035: Was bedeutet klimaneutral für Stuttgart?
Stuttgart verfolgt mit dem Klima-Fahrplan 2035 ein Ziel, das deutschlandweit Beachtung findet. Unter Klimaneutralität versteht die Stadt die drastische Reduktion klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen auf nahezu Null. Die verbleibenden Emissionen sollen durch gezielte Kompensationsmaßnahmen wie Aufforstung oder CO2-Speicherung ausgeglichen werden.
Dazu setzt die Stadt auf einen umfassenden Masterplan mit 13 Maßnahmenpaketen, die sämtliche Lebensbereiche betreffen: Strom, Wärme, Verkehr, Abfall, Landwirtschaft sowie ergänzende Maßnahmen wie CO2-Abscheidung und Kreislaufwirtschaft. Das Gesamtvolumen der erforderlichen Investitionen beläuft sich auf rund 11 Milliarden Euro – ein Großteil davon ist privat zu tragen.
Wo steht Stuttgart auf dem Weg zur Klimaneutralität?
In den vergangenen Jahren wurden bereits sichtbare Fortschritte erzielt: Die CO2-Emissionen sind seit 1990 um etwa 54 Prozent gesunken. Besonders städtische Liegenschaften dienen als Vorbilder – hier liegt die Reduktion bereits bei 75 Prozent. Auch der Primärenergieverbrauch konnte um mehr als 40 Prozent gesenkt werden.
Ein Fokus liegt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien: Der Anteil erneuerbarer Quellen am Endenergieverbrauch beträgt derzeit etwa 28 Prozent. Besonders bei der Photovoltaik hat die Stadt einen deutlichen Schub erlebt. Seit 2022 wurde die installierte Leistung auf etwa 30 Megawatt gesteigert – das Ziel ist eine weitere Verdopplung bis 2026. Auch die Elektromobilität verzeichnet Rekorde: Über 3.100 Ladepunkte sind inzwischen im Stadtgebiet installiert, was Stuttgart deutschlandweit zu einem Spitzenreiter macht.
Frage: Wie will Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden?
Stuttgart verfolgt einen breiten Maßnahmenmix: Die Stadt setzt auf den schnellen Ausbau von Solarenergie, Wärmepumpen, klimafreundliche Nahwärmenetze, eine konsequente Verkehrswende mit Fokus auf ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sowie eine Förderung der Elektromobilität. Zusätzlich gehören Kreislaufwirtschaft und innovative Speicher- sowie Abscheidungstechnologien zum Paket. Jede Maßnahme ist mit konkreten Zwischenzielen und überprüfbaren Meilensteinen hinterlegt.
Der schwierige Weg: Herausforderungen auf allen Ebenen
Trotz der Fortschritte ist klar: Der Weg zur Klimaneutralität ist noch lang – und voller Stolpersteine. Besonders die energetische Sanierung des Gebäudebestands gilt als einer der größten Engpässe. Von den rund 320.000 Gebäuden in Stuttgart müssten bis 2035 etwa 200.000 saniert werden. Doch die aktuellen Zahlen zeigen: Das Tempo reicht bei weitem nicht aus.
So wurden im ersten Halbjahr 2025 gerade einmal 363 Förderanträge für Wärmepumpen gestellt – benötigt werden jedoch rund 3.500 Installationen pro Jahr, um das Ziel von über 43.000 Geräten bis 2035 zu erreichen. Auch die finanzielle Belastung bleibt eine Herausforderung: Rund 5,9 Milliarden Euro der erforderlichen Investitionen im Gebäudesektor müssen von privaten Eigentümern aufgebracht werden. Die Stadt und der Bund bieten attraktive Förderprogramme, doch der Anreiz für viele Hauseigentümer bleibt begrenzt.
Frage: Welche Rolle spielen Hauseigentümer für ein klimaneutrales Stuttgart?
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohn- und Geschäftsgebäuden sind entscheidend für den Erfolg der Stuttgarter Klimaziele. Ohne ihre Bereitschaft zur Sanierung, zum Wechsel auf erneuerbare Heizsysteme und zur energetischen Modernisierung wird Stuttgart das Ziel nicht erreichen. Allerdings zeigen Studien: Informationen allein überzeugen nur selten. Vielmehr sind persönliche Überzeugungen, Kosten-Nutzen-Erwartungen und politische Einstellungen ausschlaggebend.
Strukturelle Herausforderungen: Zwischen Verwaltung, Politik und Praxis
Neben technischen und finanziellen Aspekten gibt es auch organisatorische Hürden. Verschiedene Analysen haben gezeigt, dass eine klare Steuerungsinstanz im Rathaus fehlt. Verkrustete Verantwortungsstrukturen und ineffiziente Prozesse bremsen die Umsetzung aus. Nicht selten stehen unterschiedliche politische Interessen dem Fortschritt im Weg – besonders wenn es um Zielkonflikte zwischen Wohnungsbau, Innenverdichtung und Klimaschutz geht.
„In diesem Tempo erreichen wir das Ziel vielleicht 2060 oder sogar erst 2100. Eine grundlegende Umstrukturierung ist dringend notwendig“, warnt ein Vertreter der lokalen Umweltgruppe.
Mobilität und Gewerbe: Der unterschätzte Hebel
Auch im Verkehrssektor sind die Herausforderungen groß – aber die Potenziale ebenso. Die Stadt setzt auf einen Mix aus Elektrifizierung des Verkehrs, Ausbau von Rad- und Fußwegen sowie eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs. Prognosen zufolge wird sich das Kfz-Verkehrsaufkommen zwar geringfügig erhöhen, dennoch sollen durch Effizienzsteigerungen und Umstiege auf alternative Mobilitätsformen erhebliche CO2-Reduktionen erzielt werden.
Ein oft übersehener Bereich sind die Gewerbe- und Industrieflächen: Sie verursachen rund 50 Prozent der städtischen Emissionen. Hier setzt Stuttgart auf Pilotprojekte für energieeffizientes Bauen, verbessertes Energiemanagement und die Modernisierung von Fuhrparks. Der Standort Weilimdorf etwa gilt als Modellquartier für die Umsetzung innovativer Klimastrategien im Gewerbe.
Frage: Welche Rolle spielen Gewerbegebiete für das Klimaziel?
Gewerbe-, Industrie- und Logistikflächen bieten große Potenziale zur CO2-Reduktion, wenn Maßnahmen wie die Umstellung auf erneuerbare Energien, Optimierung von Gebäuden und eine konsequente Elektrifizierung von Fuhrparks vorangetrieben werden. Gleichzeitig erfordern diese Umstellungen intensive Abstimmung und Investitionen der Unternehmen.
Die Bürger im Mittelpunkt: Beteiligung, Akzeptanz und Aktivierung
Eines wird in Stuttgart immer deutlicher: Ohne die breite Beteiligung und Akzeptanz der Bevölkerung werden die Klimaziele nicht erreichbar sein. Die Stadt hat daher verschiedene Formate zur Bürgerbeteiligung etabliert. Beim Klimamobilitätsplan etwa beteiligten sich über 1.000 Bürgerinnen und Bürger an Online-Foren und Bürgerrat-Initiativen. Dabei wurden Empfehlungen für klimafreundliche Wärmeversorgung, Mobilität und die Verteilung des Straßenraums erarbeitet.
Frage: Welche Empfehlungen brachte der Bürgerrat Klima Stuttgart?
Der Bürgerrat hat 24 konkrete Empfehlungen entwickelt – von der Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien bis hin zur Neugestaltung des öffentlichen Raums und zur Förderung alternativer Mobilitätsformen. Diese Empfehlungen werden jährlich im städtischen Aktionsplan überprüft und angepasst.
Ein neues Transparenzelement: Die Umsetzung wird im Rahmen des Aktionsplans 2023 jährlich evaluiert – Bürgerinnen und Bürger können Fortschritte online einsehen und kommentieren.
Kommunikation als Schlüsselfaktor: Wie spricht man die Menschen wirklich an?
Zunehmend rückt die Kommunikation ins Zentrum der Klimastrategie. Die Stadt setzt dabei bewusst auf neue Wege: Humorvolle, unkonventionelle Kampagnen – abseits klassischer Klimawording-Floskeln – sollen insbesondere Hauseigentümer erreichen. Ein Beispiel ist die stadtweite Kampagne „jetztklimachen!“, die mit Futurepoints und Pop-ups Klimaschutz erlebbar macht und nicht nur informiert, sondern aktivieren will.
Frage: Was sind Aktivierungsstrategien der Stadt, um Bürger zu motivieren?
Die Stadt Stuttgart arbeitet seit 2024 an einem neuen Aktivierungskonzept, das durch Social-Media-Berater unterstützt wird. Ziel ist eine empathische Ansprache, die zum Mitmachen einlädt, individuelle Motive berücksichtigt und konkrete Handlungsoptionen aufzeigt. Das Konzept soll im Herbst 2025 vorgestellt und breit ausgerollt werden.
Soziale Medien, Wissenschaft und lokale Initiativen: Stuttgart in der digitalen Transformation
Die Klimaneutralität ist auch in den sozialen Medien und der Wissenschaft ein Dauerthema. Stuttgarter Institutionen, Energieversorger und Umweltinitiativen nutzen Plattformen wie Twitter und Instagram, um Bürger zu informieren und zu motivieren. Hochschulforen und Fachveranstaltungen zeigen: Wissenschaft, Politik und Bürgerschaft rücken in der Klima- und Energiefrage enger zusammen.
Zudem entstehen überall im Stadtgebiet innovative Quartiersprojekte – von der Plusenergie-Kita über klimaneutrale Sporthallen bis hin zu Modellquartieren wie Botnang. Hier werden praxisnahe Lösungen für klimaneutrales Bauen und Wohnen entwickelt, die als Vorbild für ganz Stuttgart dienen können.
Die nächsten Schritte: Was Stuttgart jetzt tun muss
Der Trend zeigt: Die Zahl der Förderanträge und die Nachfrage nach klimafreundlichen Lösungen steigen. Dennoch mahnen Experten und Initiativen, dass das bisherige Tempo nicht ausreicht. Stuttgart muss die Sanierungsraten im Gebäudebestand massiv steigern, bürokratische Hürden abbauen und private Investitionen weiter mobilisieren. Gleichzeitig ist eine stärkere Koordination und Zentralisierung der Steuerungsprozesse innerhalb der Verwaltung erforderlich.
| Bereich | Aktueller Stand | Ziel 2035 | Herausforderung |
|---|---|---|---|
| Gebäude | 2.700 Wärmepumpen, 200.000 unsaniert | 43.400 Wärmepumpen, 200.000 Sanierungen | Hohe Investitionskosten, Akzeptanz |
| Erneuerbare Energien | 28% Anteil, 30 MW Photovoltaik | Verdopplung PV bis 2026 | Flächenverfügbarkeit, Motivation |
| Mobilität | 3.100 Ladepunkte | Vollständige Elektrifizierung, Ausbau ÖPNV | Verhaltensänderung, Infrastruktur |
| Gewerbe | 50% Emissionen durch Gewerbe | Energieeffizienz, alternative Antriebe | Unternehmensmotivation, Kosten |
Langfristige Perspektive: Stuttgart als Vorbild?
Die Transformation zur klimaneutralen Stadt ist ein Generationenprojekt. Stuttgart zeigt bereits heute, dass Fortschritt möglich ist – aber auch, wie groß die Herausforderungen sind. Innovative Aktivierungsmaßnahmen, digitale Transparenz und Bürgerbeteiligung werden ebenso wichtig sein wie technologische Entwicklungen und finanzielle Anreize.
Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, stärker eingebunden zu werden und eigene Beiträge zum Klimaschutz leisten zu können. Der nächste entscheidende Schritt wird sein, die Motivation und die Bereitschaft aller Akteure weiter zu stärken, damit Stuttgart das ambitionierte Ziel Klimaneutralität 2035 tatsächlich erreicht – und so zum Vorbild für andere Städte wird.