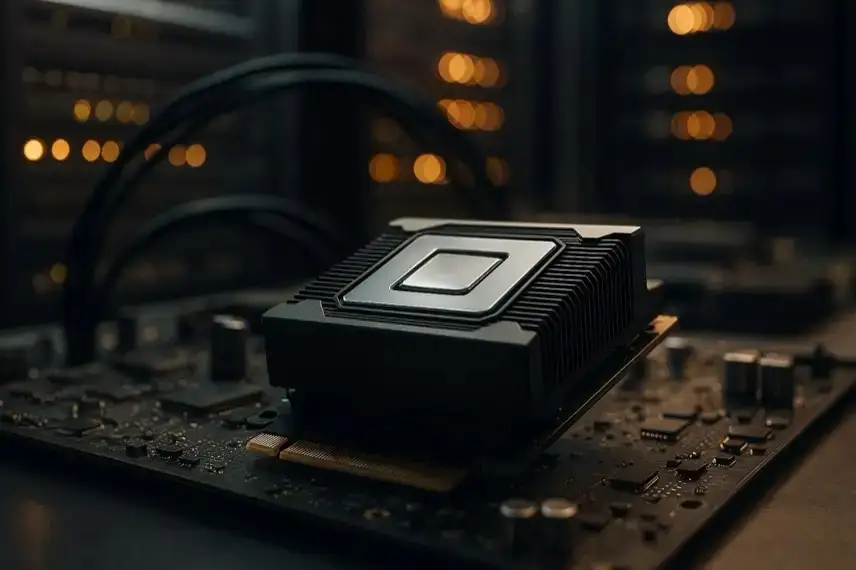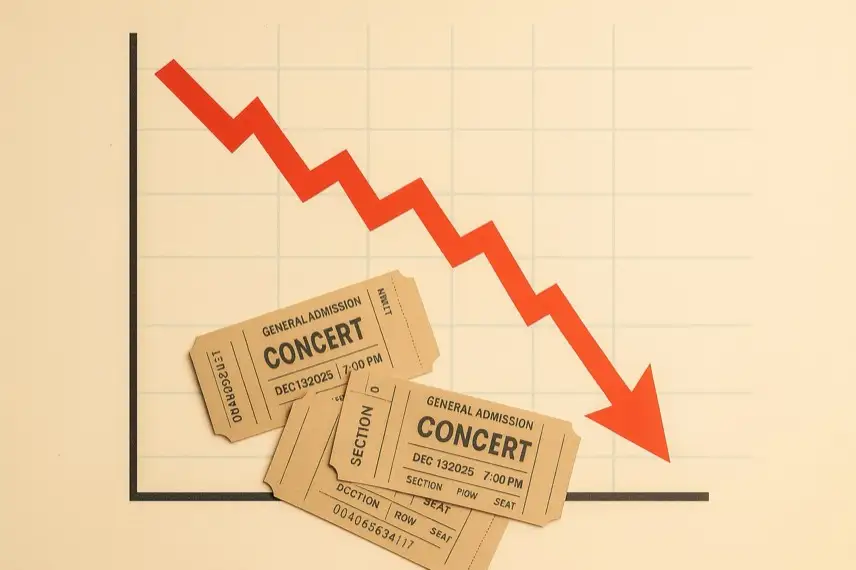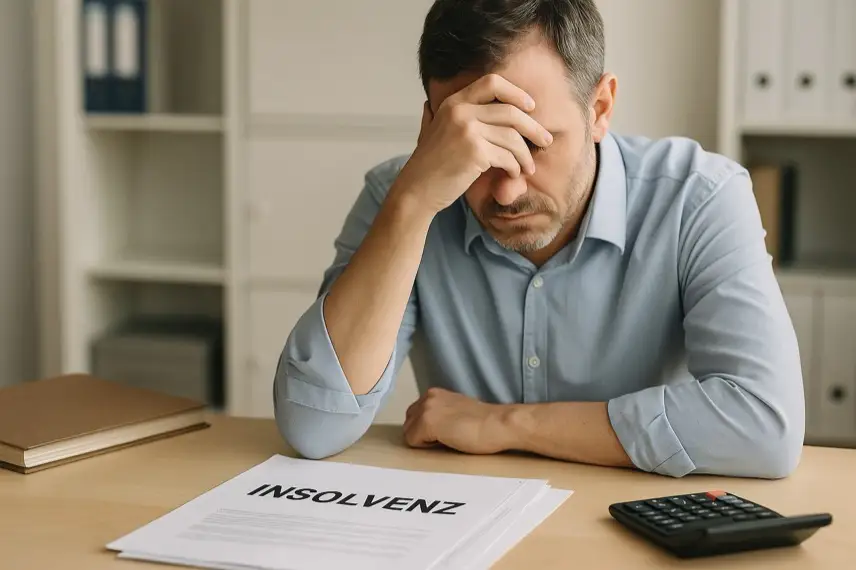Berlin – Eine tiefgreifende Reform des Bürgergelds steht bevor. Ökonomen, Politik und Sozialverbände sind sich einig: Das bestehende System weist gravierende Schwächen auf. Besonders problematisch ist, dass sich Mehrarbeit für viele Bürgergeld-Empfänger finanziell kaum auszahlt. Was steckt hinter dieser Problematik – und welche Lösungen liegen auf dem Tisch?
Das Bürgergeld-System 2025: Eine kurze Bestandsaufnahme
Seit der Einführung des Bürgergelds als Nachfolger von Hartz IV ist viel Kritik am System laut geworden. Die Idee war, Menschen durch bessere Förderung und mehr Sicherheit wieder in Arbeit zu bringen. Doch viele Beobachter sprechen heute davon, dass genau das Gegenteil eingetreten ist.
Zum 1. Januar 2025 wurde der Regelsatz für Alleinstehende auf 563 Euro angehoben, Paare erhalten jeweils 506 Euro. Hinzu kommen Leistungen für Unterkunft, Heizung und gegebenenfalls Mehrbedarfe. Doch die finanziellen Vorteile für Menschen, die sich aus eigener Kraft aus dem System herausarbeiten möchten, sind gering. In der Realität verbleiben viele im Transferbezug, obwohl sie in Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten könnten.
„Lohnt sich Arbeit überhaupt noch?“ – Eine oft gestellte Frage
Die Frage „Lohnt sich Bürgergeld bei Mindestlohn?“ beschäftigt viele Menschen – und die Antwort ist vielschichtig. Wer in Vollzeit zum gesetzlichen Mindestlohn arbeitet, hat in der Regel mehr Netto zur Verfügung als ein reiner Bürgergeldempfänger. Doch bei Teilzeitbeschäftigung oder Nebenjobs schrumpft dieser Unterschied drastisch.
Ein konkretes Beispiel: Ein Single mit einem Teilzeitjob verdient brutto 1 200 Euro. Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleiben etwa 950 Euro netto. Davon werden große Teile auf das Bürgergeld angerechnet – oft bleibt ein Netto-Mehrwert von nur wenigen Euro gegenüber dem reinen Transferbezug. Das lässt viele an der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit zweifeln.
Die Ursache liegt in der Transferentzugsrate
Ein zentrales Problem ist die sogenannte Transferentzugsrate. Sie bezeichnet den Anteil des zusätzlich verdienten Geldes, der dem Leistungsempfänger durch gekürzte Sozialleistungen oder höhere Abgaben wieder verloren geht.
Beim Bürgergeld kann diese Rate – je nach Einkommenshöhe und Haushaltskonstellation – bis zu 100 % betragen. Das bedeutet: Für jeden zusätzlich verdienten Euro kann im Extremfall ein Euro an Transferleistungen gestrichen werden. Das Resultat ist, dass Mehrarbeit beim Bürgergeld oft keinen finanziellen Vorteil bringt.
Ab welchem Brutto lohnt sich Arbeit überhaupt?
Diese Frage stellen sich viele Betroffene: „Ab welchem Brutto lohnt sich Vollzeit statt Bürgergeld?“ Studien zeigen, dass sich Arbeit meist erst ab einem Bruttogehalt von 1 200 bis 1 500 Euro rechnet. Besonders für Alleinstehende und kleine Familien ist das kritisch – denn diese Einkommensschwelle liegt nur knapp über dem Mindestlohnniveau.
Das ifo-Institut hat verschiedene Szenarien berechnet, die zeigen: Wer rund 3 500 Euro brutto verdient, hat teilweise nicht viel mehr Netto als jemand mit 5 500 Euro, weil sich höhere Einkommen negativ auf Zuschüsse und Freibeträge auswirken. Damit entstehen sogenannte „Fehlanreize“, wie sie auch Ökonom Andreas Peichl formuliert: „Das Sozialsystem ist nicht aufeinander abgestimmt.“
60 Reformvorschläge, aber noch keine Umsetzung
Peichl hat im Auftrag der Bundesregierung über 60 Reformvarianten durchgerechnet. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass eine klügere Zusammenführung von Leistungen (etwa Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag) nicht nur gerechter wäre, sondern auch den Arbeitsanreiz deutlich erhöhen würde.
Ein konkreter Reformvorschlag lautet: Erwerbstätige sollen künftig 65 % ihres Einkommens behalten dürfen, statt wie bisher nur etwa 20–30 %. Dadurch könnten laut Modellrechnungen rund 144 000 zusätzliche Vollzeitäquivalente geschaffen werden.
Die Perspektive der Jobcenter und Verwaltung
Eine oft übersehene Perspektive ist die Sicht der Jobcenter-Mitarbeitenden. In einer bundesweiten Umfrage gaben nur 20 % der befragten Beschäftigten an, dass das Bürgergeld die Motivation der Leistungsbezieher steigere. 60 % äußerten Zweifel, ob das neue System tatsächlich zu einer besseren Integration in den Arbeitsmarkt führe.
In sozialen Netzwerken wie Reddit wird zudem regelmäßig thematisiert, dass Fördermittel in der Verwaltung versickern oder nicht effizient genutzt werden. Ein Nutzer kommentierte: „Das Geld fließt nicht in Maßnahmen, sondern in die Bürokratie.“
Was denken die Bürger? Stimmen aus Foren und sozialen Medien
Auch außerhalb offizieller Studien wächst die Kritik. In Facebook-Gruppen und Kommentarspalten sprechen viele Nutzer von kosmetischen Reformen, die „nur den Namen, aber nicht das System“ ändern. Besonders umstritten ist die teilweise wieder eingeführte Sanktionierung von bis zu 30 % bei Pflichtverletzungen – sowie neue Pilotprojekte zur gemeinnützigen Arbeitspflicht in Kommunen wie Schwerin.
Gleichzeitig betonen einige Kommentatoren auch die Vorteile des Bürgergelds, insbesondere die verbesserte finanzielle Absicherung in prekären Lebenslagen. Dennoch überwiegt der Eindruck, dass „das System Leistung nicht ausreichend belohnt“, wie es eine Nutzerin auf Reddit formulierte.
Alternative Ideen: Solidarisches Bürgergeld und Steueranreize
Ein Alternativmodell ist das sogenannte „Solidarische Bürgergeld“. Es sieht eine pauschale Zahlung an alle Bürger vor, kombiniert mit einem einheitlichen Steuersatz von rund 40 %. Studien prognostizieren hier Beschäftigungszuwächse von bis zu 1,17 Millionen Stellen.
Auch das ZEW schlägt eine Reform der Grenzsteuersätze vor, sodass Aufstocker und Geringverdiener stärker von eigener Leistung profitieren. Eine gerechtere Verteilung von Freibeträgen, steuerlichen Entlastungen und Wohnzuschüssen könnte die Balance zwischen sozialer Absicherung und Eigenverantwortung verbessern.
Wie geht es weiter mit der Bürgergeld-Reform?
Die Bundesregierung plant, noch im Herbst konkrete Änderungen auf den Weg zu bringen. In der Diskussion stehen unter anderem:
- Die Anhebung der Freibeträge auf bis zu 65 %
- Eine Zusammenführung von Wohngeld und Bürgergeld
- Mehr Transparenz und Effizienz in den Jobcentern
- Eine Überprüfung der Anrechnungslogik bei Zusatzverdienst
Unklar bleibt, wie stark sich diese Maßnahmen im Alltag der Betroffenen tatsächlich auswirken. Entscheidend wird sein, ob der sogenannte „Arbeit-Anreiz“ wirklich spürbar erhöht wird – und ob auch Menschen mit geringem Qualifikationsniveau wieder einen Aufstieg im System erkennen können.
Was sagen internationale Erfahrungen?
Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt: In skandinavischen Ländern wie Dänemark führte eine Kürzung von Transfers durchaus zu mehr Arbeitsstunden – allerdings auch zu sozialen Spannungen und Belastungen, insbesondere bei Kindern. Feldstudien in Deutschland zeigen dagegen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Arbeitszeit kaum beeinflusst, aber das psychische Wohlbefinden der Empfänger deutlich steigert.
Der soziale Frieden auf dem Prüfstand
Die Debatte rund um das Bürgergeld ist mehr als eine ökonomische Diskussion – sie ist ein Prüfstein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sich Leistung nicht lohnt, sinkt nicht nur die Motivation, sondern auch das Vertrauen in den Sozialstaat.
Gleichzeitig dürfen Schwächere nicht durch Reformdruck an den Rand gedrängt werden. Es braucht ein System, das sowohl motiviert als auch absichert – ein Balanceakt, der politische Kompromissbereitschaft und langfristiges Denken erfordert. Die Bürgergeld-Reform ist daher nicht nur eine politische Herausforderung, sondern ein soziales Großprojekt mit weitreichenden Folgen für die Zukunft der Arbeit in Deutschland.