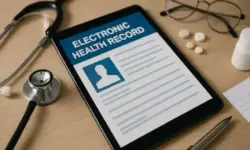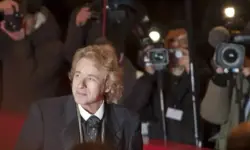25. November 2025 – Stille liegt über der winterlichen Welt, doch hinter verschlossenen Türen spielt sich ein unsichtbares Verbrechen ab. Alle zehn Minuten stirbt irgendwo auf der Welt eine Frau durch die Hand eines nahestehenden Menschen. Die Vereinten Nationen haben nun erstmals konkrete Zahlen vorgelegt – und die zeigen: Femizid ist ein globales Problem mit erschütternden Dimensionen.
Jahr 2023: Über 51.000 Femizide durch Partner oder Familie
Laut dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen wurden im Jahr 2023 weltweit rund 85.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet. In etwa 60 Prozent der Fälle – also 51.100 Opfer – war der Täter ein enger Familienangehöriger oder ein Intimpartner. Dies bedeutet: Alle zehn Minuten stirbt im Schnitt eine Frau durch Gewalt in ihrem engsten Umfeld.
Die Daten stammen aus dem gemeinsamen Bericht von UN Women und dem United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), der anlässlich des „International Day for the Elimination of Violence against Women“ veröffentlicht wurde. Besonders betroffen sind Regionen mit strukturellen Problemen im Bereich Gleichstellung und Rechtsdurchsetzung. Afrika weist mit 2,9 Femiziden pro 100.000 Frauen die höchste Rate auf, gefolgt von Amerika (1,6), Ozeanien (1,5), Asien (0,8) und Europa (0,6).
„Nicht unausweichlich – sondern vermeidbar“
UN Women-Chefin Sima Bahous unterstreicht die gesellschaftliche Verantwortung: Violence against women and girls is not inevitable—it is preventable.
Auch Ghada Waly, Exekutivdirektorin der UNODC, fordert stärkere Justizmechanismen: The new femicide report highlights the urgent need for strong criminal justice systems that hold perpetrators accountable…
Das Zuhause: Der gefährlichste Ort
Die Statistiken zeigen: Der gefährlichste Ort für Frauen ist nicht etwa eine dunkle Gasse – sondern das eigene Zuhause. Viele Opfer lebten mit dem Täter zusammen oder hatten in der Vergangenheit eine Beziehung mit ihm. Auch Trennungsphasen gelten als besonders riskant.
Eine umfassende Analyse von 24 internationalen Studien hat ergeben, dass folgende Risikofaktoren besonders häufig in Verbindung mit einem Femizid auftreten:
- Vorangegangene körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt durch den Täter
- Trennungsabsicht oder tatsächliche Trennung vom Partner
- Zugang des Täters zu Waffen
- Soziale Isolation und mangelnde Schutzmechanismen für Betroffene
Diese Erkenntnisse bestätigen, dass Femizide selten spontane Taten sind. Vielmehr sind sie häufig das Resultat wiederholter Eskalationen, Machtmissbrauchs und fehlender Schutzmaßnahmen.
Definition und Begriffsabgrenzung
Was ist ein Femizid? Nicht jeder Mord an einer Frau fällt darunter. Ein Femizid liegt dann vor, wenn das Geschlecht der Frau oder geschlechtsspezifische Strukturen eine ursächliche Rolle spielen – etwa aus Besitzanspruch, Hass, Eifersucht oder patriarchalen Machtverhältnissen.
In der gesellschaftlichen Debatte wird oft kritisiert, dass der Begriff intimate partner homicide
(Tötung durch Intimpartner) nicht ausreichend sei, da er beispielsweise Ex-Partner, Bekannte oder Familienmitglieder nicht eindeutig erfasst.
Unzureichende Erfassung und fehlende Daten
Ein großes Problem liegt in der globalen Datenlage. In vielen Ländern existieren keine einheitlichen Definitionen oder verpflichtenden Statistiken. Auch in Deutschland gibt es bis heute kein nationales Register für Femizide. Statistiken beschränken sich meist auf Fälle, in denen Täter und Opfer in einer Beziehung standen.
Expertinnen fordern seit Langem eine präzisere Erfassung und einheitliche Kategorisierung. Nur so können Muster erkannt, Prävention verbessert und Täter konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.
Digitale Gewalt als Frühwarnsignal
Ein bisher wenig beachteter Aspekt ist die Rolle digitaler Gewalt. Cyberstalking, digitale Kontrolle oder das Veröffentlichen intimer Aufnahmen sind oft Teil eines Eskalationsprozesses, der schließlich in tödlicher Gewalt münden kann. Diese Dynamiken finden im virtuellen Raum statt, bleiben aber in der Gesetzgebung und Polizeiarbeit oft unberücksichtigt.
Zivilgesellschaft und Bewegungen machen Druck
Internationale Bewegungen wie Ni Una Menos in Lateinamerika oder der britische Femicide Census dokumentieren systematisch Fälle und fordern politischen Wandel. Diese Initiativen haben das Thema Femizid weltweit stärker in den öffentlichen Fokus gerückt.
Jess Phillips, britische Ministerin für Opferschutz, würdigte die Arbeit von Aktivistinnen mit den Worten: The effort that they have undertaken has changed the world already.
Auch auf Plattformen wie Reddit diskutieren Betroffene, Fachleute und Interessierte über Definitionen, Schutzmechanismen und Prävention. Eine häufig geäußerte Kritik: Die offiziellen Kategorien seien zu eng gefasst, viele Bedrohungslagen würden nicht erfasst.
Warum Meldungen allein nicht reichen
Eine internationale Vergleichsstudie zeigte einen überraschenden Zusammenhang: In Ländern mit hoher Anzeigequote häuslicher Gewalt oder Quotenregelungen für weibliche politische Teilhabe stieg die Zahl der Femizide zum Teil sogar. Forschende sprechen hier von einem Backlash-Effekt
– einer gewaltsamen Reaktion auf wachsende weibliche Selbstbestimmung.
Diese Ergebnisse unterstreichen, dass allein rechtliche Fortschritte oder mehr Sichtbarkeit nicht ausreichen. Es braucht einen tiefgreifenden kulturellen Wandel, der patriarchale Denkmuster infrage stellt – in Familien, Behörden, Bildung und Medien.
Wie kann Femizid verhindert werden?
Die gesammelten Daten und Studien legen nahe, dass Prävention auf mehreren Ebenen ansetzen muss:
- Frühzeitige Risikoerkennung durch Polizei, Schulen, Nachbarschaft
- Zugang zu Schutzunterkünften und rechtlicher Beratung für betroffene Frauen
- Verbindliche Erfassung von Gewaltverläufen – auch digital
- Entwaffnung potenzieller Täter
- Langfristige Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen Rollenbilder und Gewaltmuster
Ein Bild der Entschlossenheit
Symbolbilder wie das von drei Frauen mit verschränkten Armen im Winter zeigen: Der Widerstand ist da. Die Empörung wächst. Doch Worte müssen zu Taten werden – auf allen Ebenen der Gesellschaft.
Ein globales Schweigen, das gebrochen werden muss
Der neue UN-Bericht bringt das Schweigen zum Brechen. Er macht sichtbar, was allzu oft ignoriert wird: Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen, sondern eine alltägliche Gefahr – weltweit, systematisch und tödlich. Doch Femizide sind kein Schicksal. Sie sind ein Resultat fehlender Intervention, gescheiterter Schutzsysteme und gesellschaftlicher Ignoranz. Umso wichtiger ist es, die Zahlen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern zu handeln: konsequent, präventiv, solidarisch.