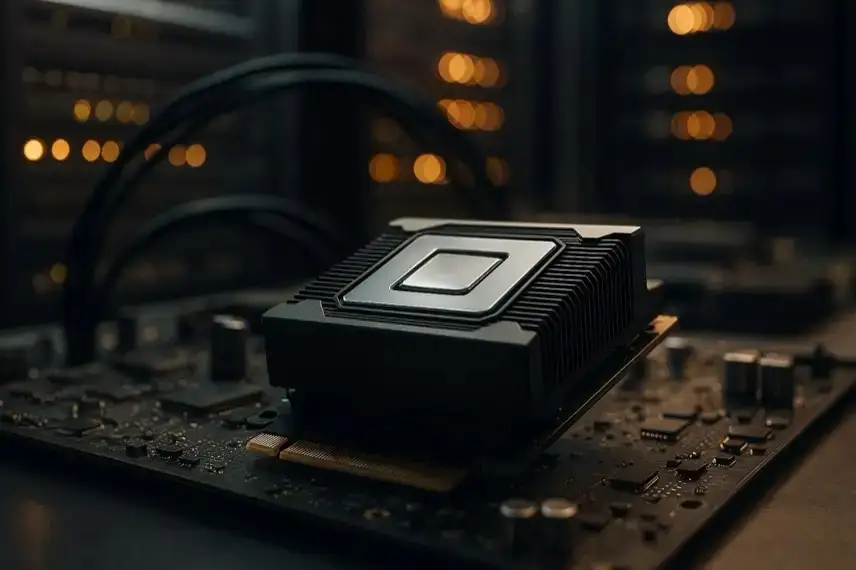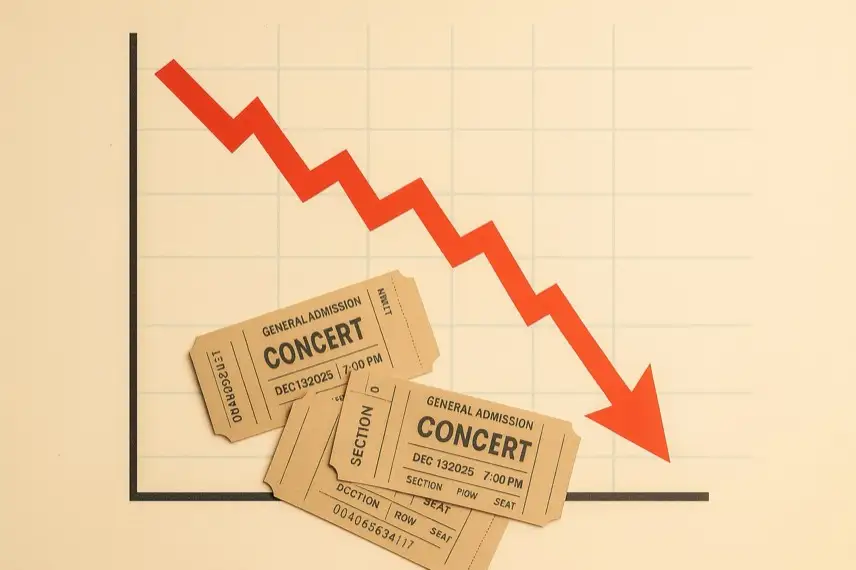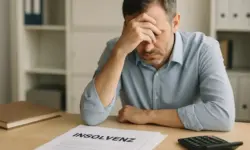Ein Pilotprojekt des Finanzamts Kassel rückt in den Fokus: Erstmals erhalten tausende Steuerpflichtige eine automatisch erstellte Einkommensteuererklärung vom Finanzamt. Das Projekt trägt den Namen „Die Steuer macht jetzt das Amt“ und könnte die Steuerbürokratie in Deutschland nachhaltig verändern. Doch während einige Bürger von Vorteilen berichten, warnen Experten vor Risiken und offenen Fragen.
Ein Pilotprojekt mit Signalwirkung
Im Jahr 2025 testet das Finanzamt Kassel ein bundesweit einzigartiges Verfahren: Anstatt Bürgerinnen und Bürger zur Abgabe der Steuererklärung aufzufordern, erstellt das Amt selbst einen Steuerbescheidvorschlag. Grundlage sind die Daten, die dem Finanzamt bereits vorliegen – etwa von Arbeitgebern, Krankenkassen, Rentenkassen und Versicherungen. Rund 6.000 Steuerpflichtige im Bereich des Finanzamts Kassel sind Teil dieser neuen Vorgehensweise. Wer den Vorschlag erhält, hat vier Wochen Zeit, diesen zu prüfen oder gegebenenfalls zu ergänzen. Bleibt eine Reaktion aus, gilt der Bescheid als akzeptiert und wird automatisch erlassen.
Die Zielgruppe ist klar umrissen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne steuerliche Vertretung, die ihre Einkommensteuererklärung für 2024 noch nicht eingereicht haben, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Damit soll der Verwaltungsaufwand sinken, gleichzeitig sollen Bürgerinnen und Bürger, die sonst oft die Fristen verpassen, entlastet werden.
Wer darf teilnehmen – und wie läuft das Verfahren ab?
Viele Bürger stellen sich die Frage: „Wer darf beim Pilotprojekt ‚Die Steuer macht jetzt das Amt‘ in Kassel teilnehmen?“ Die Antwort: Teilnehmen dürfen Steuerpflichtige, die im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Kassel leben, keinen Steuerberater beauftragt haben und deren relevante Steuerdaten dem Amt vollständig vorliegen. Damit sind insbesondere Angestellte und Rentner im Fokus, deren Einkünfte standardisiert und elektronisch übermittelt werden.
Der Ablauf gestaltet sich simpel: Nach Ablauf der regulären Abgabefrist erhalten ausgewählte Bürger keinen Mahnbrief, sondern einen automatisch generierten Vorschlag für ihre Steuerfestsetzung. Dieser enthält alle bereits bekannten Daten. Nun liegt es am Steuerpflichtigen, innerhalb von vier Wochen Einwände zu erheben oder zusätzliche Aufwendungen, wie etwa Werbungskosten oder Sonderausgaben, über ELSTER nachzureichen. Bleibt die Rückmeldung aus, wird der Bescheid wirksam.
Die Chancen für Bürger und Verwaltung
Das hessische Finanzministerium sieht in dem Projekt eine klare Chance zur Entlastung. Finanzminister Alexander Lorz betonte in öffentlichen Äußerungen, dass die Steuerverwaltung so serviceorientierter und digitaler auftreten könne. Auch die Bürger selbst könnten profitieren: Sie sparen Zeit, Papierkram und bürokratische Hürden. Ein in den Medien bekannt gewordenes Beispiel verdeutlicht dies: Christian Brill aus Hofgeismar erhielt durch das Pilotprojekt eine Rückerstattung von 800 Euro mehr als in den Jahren zuvor, als er seine Erklärung selbst erstellte.
Darüber hinaus kann das Projekt auch der Verwaltung zugutekommen. Wenn sich die Zahl der Fristversäumnisse reduziert, können Finanzbeamte ihre Kapazitäten effizienter nutzen. Der automatische Ablauf spart zudem Bearbeitungszeit, da die Daten ohnehin digital im System vorliegen.
Risiken und Kritikpunkte
Doch die Euphorie ist nicht ungeteilt. Steuerexperten und Fachportale warnen davor, den automatischen Vorschlag ungeprüft zu akzeptieren. Viele individuelle steuerliche Besonderheiten sind dem Finanzamt nicht bekannt. Dazu zählen etwa:
- Werbungskosten, die über den Pauschbetrag hinausgehen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerkosten
- Außergewöhnliche Belastungen, z. B. Krankheitskosten
- Nebeneinkünfte, wie Mieteinnahmen oder Kapitalerträge
Die berechtigte Frage lautet daher: „Welche Risiken gibt es, wenn man den Vorschlag ungeprüft akzeptiert?“ Das Risiko liegt darin, bares Geld zu verschenken. Wer zusätzliche Kosten oder Sonderfälle nicht angibt, erhält möglicherweise eine geringere Rückerstattung oder zahlt zu viel Steuern. Kritiker fürchten daher, dass viele Bürger den Vorschlag aus Bequemlichkeit einfach hinnehmen – und sich dadurch langfristig selbst schaden.
Ein Blick auf die Zahlen
Die bisherigen Ergebnisse des Pilotprojekts sprechen eine klare Sprache: Von den rund 6.000 angeschriebenen Steuerpflichtigen haben bereits etwa 4.700 einen Vorschlag erhalten. Einige Bescheide sind schon endgültig erlassen. Diese Zahlen zeigen, dass das Modell in großem Stil getestet wird. Sollte sich der Erfolg bestätigen, wird über eine Ausweitung auf andere Finanzämter oder sogar auf Bundesebene nachgedacht – möglicherweise ab dem Jahr 2026.
Stimmen aus der Praxis und aus Foren
In Online-Foren wie der Finanztip-Community und im offiziellen ELSTER-Forum diskutieren Bürger lebhaft über das Projekt. Besonders häufig geht es um die Frage, wie man mit Unzufriedenheit beim Vorschlag umgeht. Die Antwort lautet: Wer nicht einverstanden ist, muss innerhalb von vier Wochen selbst aktiv werden und eine eigene Steuererklärung einreichen. Andernfalls tritt der Vorschlag automatisch in Kraft. In den Foren warnen erfahrene Nutzer davor, das Schreiben einfach liegen zu lassen, ohne die Angaben genau zu prüfen.
Auch auf sozialen Medien wie X und Instagram nutzt das hessische Finanzministerium kurze Erklärvideos, um die Vorgehensweise zu erläutern. Dort wird vor allem die 4-Wochen-Frist hervorgehoben. Zudem wird die mögliche Ausweitung des Projekts thematisiert, was zeigt, dass es nicht nur ein regionales Experiment bleiben könnte, sondern als Blaupause für ganz Deutschland dienen soll.
Fragen, die Bürger jetzt stellen
Viele Fragen drehen sich um die praktische Umsetzung. Eine davon lautet: „Muss ich trotzdem eine Steuererklärung einreichen, wenn ich mit dem Vorschlag des Finanzamts nicht einverstanden bin?“ Die klare Antwort: Ja. Der Vorschlag ersetzt die Steuererklärung nur dann, wenn er akzeptiert wird oder keine Einwände erfolgen. Wer Ergänzungen machen will, muss diese über ELSTER nachtragen oder eine eigene Erklärung abgeben.
Eine weitere oft gestellte Frage: „Was passiert, wenn ich nichts unternehme, nachdem ich den Vorschlag erhalten habe?“ In diesem Fall gilt der Bescheid nach Ablauf der Frist automatisch als akzeptiert. Es erfolgt kein zusätzlicher Hinweis oder zweite Mahnung. Für viele Betroffene ist das bequem – birgt aber auch das Risiko, dass ungenutzte Steuerpotenziale verloren gehen.
Vergleich zu internationalen Modellen
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass Deutschland hier keine völlige Pionierarbeit leistet. Länder wie Dänemark oder Estland nutzen seit Jahren Systeme, bei denen Steuerpflichtige einen vorgefertigten Steuerbescheid erhalten und diesen nur noch bestätigen müssen. Auch dort ist die Akzeptanz hoch, allerdings sind die Datenbestände oftmals vollständiger und digitaler als in Deutschland. Ob ein solches Modell hierzulande ähnlich erfolgreich umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von der Datenqualität ab.
Die Rolle der Mitwirkungspflichten
Juristen verweisen darauf, dass auch im Pilotprojekt die sogenannten Mitwirkungspflichten bestehen bleiben. Das bedeutet: Steuerpflichtige sind weiterhin verpflichtet, alle relevanten Angaben zu machen. Der Vorschlag entbindet nicht von der Verantwortung, die eigenen steuerlichen Verhältnisse korrekt darzustellen. Wer beispielsweise Nebeneinkünfte verschweigt oder versehentlich nicht ergänzt, riskiert falsche Festsetzungen – im schlimmsten Fall sogar steuerrechtliche Konsequenzen.
Perspektiven und mögliche Ausweitung
Das Pilotprojekt ist zunächst auf die Region Kassel beschränkt. Doch schon jetzt wird diskutiert, wie es weitergehen könnte. Sollte sich zeigen, dass der Ansatz sowohl Bürgern als auch der Verwaltung Vorteile bringt, könnte das Modell auf ganz Hessen und später auf andere Bundesländer ausgeweitet werden. Ziel ist es, die Steuerbürokratie langfristig zu verschlanken und die Abgabeprozesse zu vereinfachen.
Finanzminister Lorz betont, dass es sich um ein Experiment mit klarer Lernkurve handelt: „Wir wollen herausfinden, ob ein solcher Service auf breite Zustimmung stößt und ob die Verwaltung damit effizienter wird.“ Erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind gemischt – während einige von positiven Überraschungen berichten, zeigen sich andere skeptisch und verweisen auf mögliche Nachteile.
Fazit der bisherigen Erfahrungen
Das Pilotprojekt des Finanzamts Kassel markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer modernen, digitalen Steuerverwaltung. Es eröffnet Chancen auf weniger Bürokratie, schnellere Bearbeitung und potenziell höhere Rückerstattungen für Bürger. Gleichzeitig dürfen die Risiken nicht übersehen werden. Wer zusätzliche Kosten oder Einkünfte hat, sollte den Vorschlag kritisch prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Andernfalls droht, dass Geld verschenkt oder falsche Bescheide erlassen werden.
Für die Finanzverwaltung könnte das Projekt langfristig enorme Effizienzgewinne bringen. Ob es jedoch bundesweit Schule macht, hängt davon ab, ob sich das Modell in der Praxis bewährt und ob die Bürger das Vertrauen entwickeln, den Vorschlägen des Finanzamts tatsächlich zu folgen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob aus einem regionalen Pilotprojekt eine bundesweite Steuerrevolution wird – oder ob die klassischen Steuererklärungen noch lange die Regel bleiben.