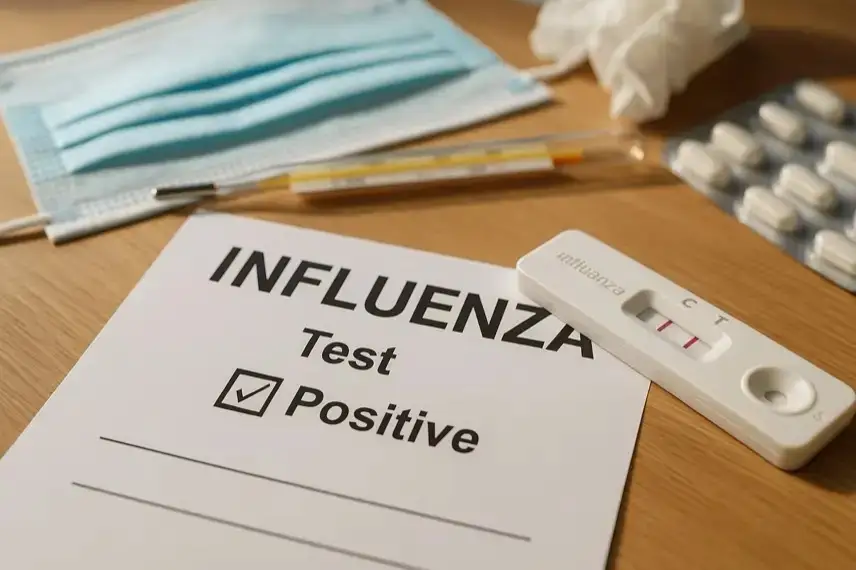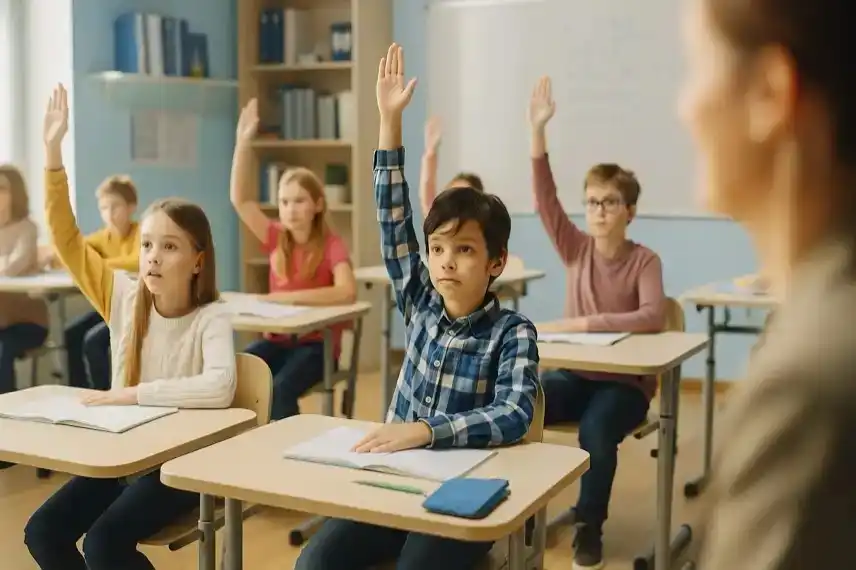
Was der IQB-Bildungstrend misst
Alle drei Jahre untersucht das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler in Deutschland die bundesweiten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) erreichen. 2024 standen die Fächer Mathematik sowie die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik im Mittelpunkt. Rund 50.000 Jugendliche aus der neunten Jahrgangsstufe nahmen an den Tests teil. Ziel ist es, ein repräsentatives Bild der Kompetenzen in allen Bundesländern zu gewinnen und Bildungsentwicklungen im Zeitverlauf sichtbar zu machen.
Fachwissen und Erkenntnisgewinnung im Fokus
Geprüft werden nicht nur reine Rechenfertigkeiten, sondern auch das Verständnis naturwissenschaftlicher Zusammenhänge und die Fähigkeit, Experimente oder Problemlösungen methodisch korrekt zu interpretieren. Das Konzept orientiert sich an den Kompetenzbereichen Fachwissen und Erkenntnisgewinnung, die für alle MINT-Fächer einheitlich gelten.
Ergebnisse: Mathe wird zum Sorgenfach
Die Zahlen des IQB-Bildungstrends 2024 sind deutlich: Knapp neun Prozent der getesteten Jugendlichen erreichen nicht einmal die Mindeststandards für den Ersten Schulabschluss (ESA) in Mathematik. Besonders alarmierend ist jedoch der Anteil jener, die die Anforderungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) verfehlen – er liegt bei rund 34 Prozent. Unter den Jugendlichen mit dem Ziel Mittlere Reife scheitert damit fast jede beziehungsweise jeder Vierte in Mathematik an den bundesweit geltenden Kompetenzzielen.
Naturwissenschaften im Abwärtstrend
Auch die Naturwissenschaften zeigen deutliche Rückgänge. In Chemie verfehlen 25 Prozent der Jugendlichen die Standards, in Physik rund 16 Prozent und in Biologie etwa 10 Prozent. Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Deutschlands Schülerinnen und Schüler verlieren zunehmend den Anschluss in den MINT-Fächern, die für technologische und wirtschaftliche Innovation von zentraler Bedeutung sind.
Bundesländer im Vergleich
Im Ländervergleich schneiden Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich ab. Schwächere Ergebnisse zeigen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und das Saarland. Die regionalen Unterschiede verdeutlichen, wie unterschiedlich die Schulsysteme der Länder wirken – und wie stark Ausstattung, Lehrkräfteversorgung und Unterrichtsqualität das Kompetenzniveau beeinflussen.
Ursachen für die Leistungseinbrüche
Die Ursachen der negativen Entwicklung sind vielschichtig. Expertinnen und Experten nennen neben der Corona-Pandemie vor allem strukturelle Probleme im deutschen Bildungssystem. Dazu zählen ein eklatanter Lehrkräftemangel, überfüllte Klassen, unzureichende Förderung leistungsschwächerer Kinder und ein Mangel an moderner Unterrichtsgestaltung. Der IQB-Bildungstrend macht zudem deutlich, dass die soziale Herkunft weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Bildungserfolg hat – Kinder aus bildungsfernen Haushalten verfehlen die Standards deutlich häufiger als Gleichaltrige aus akademischen Familien.
Die Folgen der Pandemie
Die Nachwirkungen der Corona-Zeit wirken bis heute nach. Unterrichtsausfälle, Homeschooling und fehlende soziale Kontakte haben insbesondere in den MINT-Fächern Spuren hinterlassen. Lehrkräfte berichten von deutlichen Lücken in Grundlagenwissen und Arbeitsdisziplin. Selbst in gymnasialen Bildungsgängen seien Defizite sichtbar, die sich ohne gezielte Förderung kaum ausgleichen ließen.
Motivation und Unterrichtsqualität
Nach Erkenntnissen der begleitenden Studien hängt der Lernerfolg stark von der Motivation der Lehrkräfte ab. Begeisterung für das Fach und gute Didaktik wirken sich messbar auf das Leistungsniveau aus. In vielen Schulen aber fehlt es an Zeit und Ressourcen für individualisierten Unterricht. Schülerinnen und Schüler empfinden Mathematik und Naturwissenschaften zudem häufig als „schwer“ und „fern vom Alltag“ – ein Signal, dass Unterrichtskonzepte stärker an Lebenswelten anknüpfen müssen.
Digitalisierung bleibt Schwachpunkt
Nur rund ein Viertel der Neuntklässler gibt laut Bildungstrend an, regelmäßig digitale Medien für schulische Aufgaben zu nutzen. Deutschland bleibt damit hinter anderen OECD-Staaten zurück. Fehlende Ausstattung, instabile Internetverbindungen und mangelnde digitale Kompetenzen verhindern vielerorts einen zeitgemäßen Unterricht. Das wirkt sich gerade in MINT-Fächern negativ aus, wo Simulationen, Datenanalysen und visuelle Lernhilfen entscheidende Werkzeuge sein könnten.
Reaktionen und bildungspolitische Debatte
Die Kultusministerkonferenz zeigte sich angesichts der Zahlen besorgt und sprach von einem „Weckruf für das gesamte Bildungssystem“. Bildungsforscher fordern gezielte Programme zur Stärkung der Basiskompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften. Der Deutsche Lehrerverband plädiert für kleinere Klassen, mehr Förderstunden und eine stärkere Verankerung von praxisorientierten MINT-Angeboten bereits ab der Grundschule.
Landesweite Initiativen gefordert
Mehrere Länder kündigten bereits an, die eigenen Lehrpläne und Förderstrukturen zu überprüfen. In Bayern und Sachsen sollen gezielte Programme zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Lernrückständen aufgesetzt werden. Nordrhein-Westfalen plant laut Bildungsministerium ein Sofortprogramm zur Lehrkräftequalifizierung in Mathematik und Naturwissenschaften.
Was jetzt getan werden muss
Der IQB-Bildungstrend 2024 verdeutlicht, dass Deutschlands Bildungssystem an einem Scheideweg steht. Um die Lücke in den MINT-Fächern zu schließen, sind entschlossene Maßnahmen erforderlich: bessere Ausstattung, digitale Lernkonzepte, moderne Didaktik und mehr Chancengerechtigkeit. Bildungsexpertinnen und -experten sehen darin nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit – denn die Innovationsfähigkeit des Landes hängt direkt von der Qualität der schulischen Ausbildung ab.
Ausblick
Die endgültigen IQB-Daten werden in den kommenden Monaten veröffentlicht und könnten den politischen Diskurs weiter befeuern. Schon jetzt ist klar: Deutschland muss stärker in Bildung investieren, um mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen seiner Jugendlichen zu sichern. Der Bildungstrend 2024 ist damit nicht nur ein Warnsignal – er ist ein Auftrag zum Handeln.