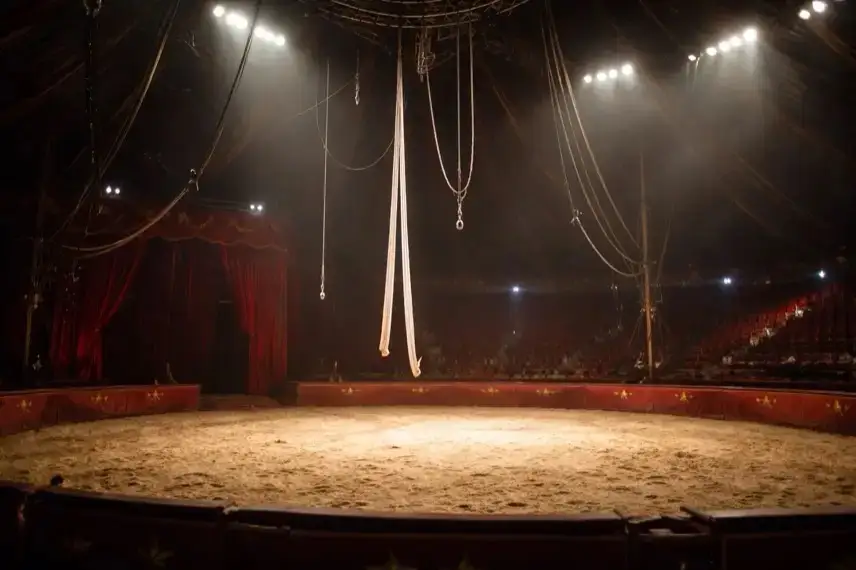Stuttgart. Trotz einer schwächelnden Wirtschaft und deutlichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer bleibt die Finanzlage der Landeshauptstadt vielschichtig. Während einzelne Steuerarten stagnieren oder zurückgehen, sorgen andere Einnahmequellen für punktuelle Stabilisierung. Doch die Zahlen offenbaren: Die Vorstellung, Stuttgart nehme insgesamt „mehr Steuern“ ein, hält einer genaueren Prüfung nicht stand.
Rekordeinnahmen sind Geschichte
Noch 2023 konnte Stuttgart mit rund 1,635 Milliarden Euro Gewerbesteuer einen historischen Höchststand verbuchen. Haupttreiber dieser Summe war die starke Ertragslage der ansässigen Automobilkonzerne und Zulieferer. Doch dieser Höhenflug fand ein jähes Ende: Bereits 2024 sanken die Gewerbesteuereinnahmen auf etwa 1,1 Milliarden Euro. Für 2025 rechnet die Stadt aktuell nur noch mit rund 850 Millionen Euro – ein Rückgang von fast 50 Prozent innerhalb von zwei Jahren.
Ein wichtiger Faktor für diesen Absturz ist die Branchenabhängigkeit. Die schwache Nachfrage, insbesondere im E-Auto-Segment, Margendruck und globale Konkurrenz belasten die Gewinne von Mercedes-Benz, Porsche und weiteren Akteuren der Wertschöpfungskette. Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die Steuerzahlungen, wie Stimmen aus der Kfz-Branche bestätigen: „Die Zeiten der zweistelligen Renditen sind vorbei. Wir spüren den Druck in jedem Quartal.“
Defizite trotz hoher Einnahmen
Auch wenn 850 Millionen Euro Gewerbesteuer immer noch eine beträchtliche Summe darstellen, klafft im Gesamthaushalt eine enorme Lücke. Der Jahresabschluss 2024 wies erstmals seit 2010 ein negatives ordentliches Ergebnis aus: Minus 6,8 Millionen Euro. Für 2025 wird ein Defizit von rund 890 Millionen Euro erwartet. Der Grund liegt nicht allein in sinkenden Steuereinnahmen, sondern auch in stark steigenden Ausgaben, etwa für Sozialleistungen, Personal und Zuschüsse.
Die Frage, „Können sinkende Gewerbesteuereinnahmen durch andere Steuern ausgeglichen werden?“, lässt sich daher nur teilweise bejahen. Zwar fließen aus dem Finanzausgleich des Landes, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie aus der Grunderwerbsteuer zusätzliche Gelder nach Stuttgart. Diese Beträge wachsen jedoch nur moderat und können den dramatischen Rückgang aus der Gewerbesteuer nicht vollständig kompensieren.
Die Rolle der Grundsteuerreform
Zum 1. Januar 2025 trat in Stuttgart die Grundsteuerreform in Kraft. Der Hebesatz wurde von 520 Prozent auf 160 Prozent gesenkt, um die vom Land geforderte Neubewertung umzusetzen. Ziel der Stadt war es, das Aufkommen aufkommensneutral zu gestalten. Das heißt: Insgesamt sollte nicht mehr oder weniger eingenommen werden, lediglich die Belastung verschiebt sich je nach Grundstückswert und Lage.
In der Praxis sorgt dies jedoch für starke individuelle Unterschiede. In sozialen Medien berichten Stuttgarter Eigentümer von enormen Steigerungen – teilweise bis zu 2.000 Euro Mehrbelastung pro Jahr für größere Grundstücke. Andere wiederum verzeichnen deutliche Entlastungen, teils um mehrere Hundert Euro. Solche Verschiebungen führen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zu dem Eindruck, die Stadt „verdiene“ plötzlich mehr, obwohl die Gesamtsumme stabil bleiben soll.
Diese Diskrepanz erklärt, warum Nutzerfragen wie „Wirkt sich die Grundsteuerreform in Stuttgart wirklich auf das Aufkommen aus?“ häufig gestellt werden. Die klare Antwort lautet: Nein – das Gesamtaufkommen bleibt nahezu unverändert, doch für einzelne Eigentümer oder Mieter kann die Veränderung sehr spürbar sein.
Soziale Medien als Spiegel der Stimmung
In Foren und auf Plattformen wie Reddit oder X ist die Stimmung zum Thema Grundsteuerreform gemischt. Einige Nutzer äußern Unverständnis darüber, dass trotz sinkender Hebesätze die eigene Belastung steigt. Die Ursache liegt in der veränderten Berechnungsgrundlage: Ein stark gestiegener Messbetrag kann den gesenkten Hebesatz überkompensieren. Andere Stimmen loben hingegen, dass ihre Grundsteuerlast erstmals seit Jahren sinkt.
Dieses Bild zeigt: Die öffentliche Wahrnehmung von „mehr Steuern“ hat nicht zwingend etwas mit den Gesamteinnahmen der Stadt zu tun, sondern stark mit der persönlichen Situation des Einzelnen.
Landesweiter Kontext und Steuertrends
Die Mai-Steuerschätzung 2025 für Baden-Württemberg prognostiziert nur leicht steigende kommunale Steuereinnahmen. Mittelfristig, ab 2026, könnten die Zuwächse sogar wieder niedriger ausfallen. Im Bundesdurchschnitt stiegen die Hebesätze für die Grundsteuer B zuletzt deutlich, Stuttgart ist hier ein Sonderfall: Die Stadt senkte den Satz, um die Reformvorgaben des Landes umzusetzen.
Gleichzeitig haben viele andere Kommunen bundesweit die Gelegenheit genutzt, ihre Hebesätze über das Aufkommensneutralitätsziel hinaus zu erhöhen, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das zeigt, dass Stuttgart – trotz hoher Defizite – bislang von einem solchen Schritt abgesehen hat.
Warum steigen Steuereinnahmen manchmal trotz Krise?
Eine der meistgestellten Fragen lautet: „Warum steigen die Steuereinnahmen in Stuttgart trotz Wirtschaftskrise?“ Die Antwort liegt in der Struktur der Einnahmequellen. Auch in konjunkturell schwierigen Zeiten können bestimmte Steuerarten oder Zuweisungen stabil oder sogar leicht steigend sein. Beispielsweise können Einkommensteueranteile durch Tarifsteigerungen wachsen, selbst wenn die Wirtschaftsleistung insgesamt stagniert. Zudem wirken Ausgleichszahlungen des Landes stabilisierend.
Für Stuttgart gilt jedoch: Diese Effekte reichen nicht aus, um den massiven Gewerbesteuereinbruch auszugleichen. Ein pauschaler „Steueranstieg“ ist daher irreführend.
Wie stark ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer?
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 1,635 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf voraussichtlich 850 Millionen Euro im Jahr 2025 – das ist ein Rückgang um knapp 50 Prozent. Besonders drastisch ist der Einbruch bei den Beiträgen der Automobilhersteller, die sich von 523 Millionen Euro auf rund 278 Millionen Euro halbiert haben. Banken und Versicherungen leisten zwar weiterhin einen stabilen Beitrag von knapp 190 Millionen Euro, können den Verlust der Autoindustrie jedoch nicht kompensieren.
Alltagsrelevanz: Die Grundsteuer im Fokus
Für viele Bürgerinnen und Bürger ist nicht die Gewerbesteuer, sondern die Grundsteuer das sichtbarste Steuerthema. Da sie über die Nebenkostenabrechnung auch auf Mieter umgelegt werden kann, spüren Haushalte die Änderungen direkt. Das sorgt für Diskussionen in Mietforen und bei Eigentümergemeinschaften, bei denen oft Missverständnisse über den Zusammenhang zwischen Hebesatz, Messbetrag und Gesamtaufkommen bestehen.
Typische Missverständnisse laut Forendiskussionen
- „Der Hebesatz ist gesunken, also muss ich weniger zahlen.“ – Falsch: Ein höherer Messbetrag kann den Vorteil übersteigen.
- „Die Stadt hat die Grundsteuer erhöht.“ – Nicht zwingend: Bei Stuttgart ist das Ziel aufkommensneutral, auch wenn einzelne stärker belastet werden.
- „Die Mehreinnahmen fließen in neue Projekte.“ – In der aktuellen Haushaltslage fließen zusätzliche Beträge eher in die Konsolidierung.
Was die kommenden Jahre bringen könnten
Die Finanzlage der Landeshauptstadt hängt stark von der wirtschaftlichen Erholung der Automobilbranche ab. Sollte sich die Nachfrage stabilisieren und die Gewinne der Hersteller wieder steigen, könnte auch die Gewerbesteuer anziehen. Parallel dazu könnte die Stadt gezwungen sein, bei anhaltenden Defiziten über moderate Hebesatzerhöhungen nachzudenken – sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Grundsteuer.
Einige kommunalpolitische Stimmen warnen jedoch, dass eine Steuererhöhung in wirtschaftlich schwachen Phasen kontraproduktiv sein könnte. Stattdessen setzen sie auf Ausgabenkürzungen, Priorisierung von Projekten und die Nutzung von Rücklagen.
Die Automobilkrise als Haushaltsrisiko
Die Frage „Wie beeinflusst die Automobilkrise die kommunalen Finanzen in Stuttgart?“ ist zentral für das Verständnis der aktuellen Lage. Stuttgart ist in hohem Maß von den Gewinnen seiner Autohersteller abhängig. Wenn diese Gewinne sinken, bricht ein wesentlicher Teil der kommunalen Einnahmen weg. Genau das passiert derzeit – und es betrifft nicht nur die Stadt, sondern auch das Land Baden-Württemberg und andere Autostädte wie Wolfsburg oder Ingolstadt.
Schlussgedanken
Die Finanzsituation Stuttgarts ist ein Lehrbeispiel dafür, wie komplex kommunale Haushalte aufgebaut sind und wie irreführend vereinfachte Schlagzeilen sein können. Einzelne Steuerarten können steigen, während andere dramatisch einbrechen. Für den Bürger zählt oft nur, ob er persönlich mehr oder weniger zahlt – und das führt zu ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen.
Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, ob es der Stadt gelingt, die Einnahmeseite zu stabilisieren, ohne die Steuerlast einseitig zu erhöhen. Dabei spielen nicht nur wirtschaftliche Entwicklungen und Branchenzyklen eine Rolle, sondern auch politische Entscheidungen und die Fähigkeit, die eigene Haushaltsstruktur nachhaltig zu gestalten.