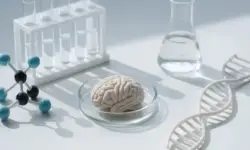Essstörungen führen zunehmend zu stationären Behandlungen – besonders bei Mädchen und jungen Frauen. Dieser Beitrag ordnet die aktuellen Trends ein, erklärt Ursachen und Risiken und skizziert, was Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung empfehlen. Mit Blick auf Datenqualität, Versorgungspfade und neue Entwicklungen entsteht ein präzises Bild der Lage – fundiert, differenziert und praxisrelevant.
Begriffsbestimmung und Klassifikation
Essstörungen sind psychische Störungen, die durch persistente Veränderungen des Essverhaltens und eine übermäßige Bedeutung von Gewicht, Figur und Kontrolle des Essens gekennzeichnet sind. International maßgeblich sind die Klassifikationssysteme ICD-11 und DSM-5-TR. Zu den Kerndiagnosen zählen Anorexia nervosa (AN), Bulimia nervosa (BN), die Binge-Eating-Störung (BED) sowie ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) und weitere spezifizierte Störungsbilder. Während ICD-11 und DSM-5-TR in den Hauptkategorien weitgehend übereinstimmen, können Unterschiede in Schwellenkriterien und Spezifizierungen die epidemiologische Erfassung beeinflussen.
Für die klinische Praxis bedeutsam ist die Abgrenzung zwischen diagnostischen Kernmerkmalen (z. B. Untergewicht, Essanfälle, kompensatorisches Verhalten) und aufrechterhaltenden Faktoren (z. B. kognitive Verzerrungen, Emotionsregulation, interpersonelle Dynamiken). Screening-Instrumente wie SCOFF und Selbstbeurteilungsmaße wie das Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) werden in Forschung und Versorgungsmonitoring eingesetzt, ersetzen jedoch nicht die strukturierte klinische Diagnose.
Epidemiologische Lage: Deutschland und internationale Perspektiven
In Deutschland ist für die vergangenen zwei Jahrzehnte ein deutlicher Anstieg stationärer Behandlungen bei Essstörungen dokumentiert, der sich bei Mädchen und jungen Frauen besonders stark zeigt. In der Altersgruppe von späten Kindheits- bis Jugendjahren nimmt die Inanspruchnahme stationärer Versorgung überproportional zu. Dieser Trend ist international beobachtbar, wenn auch mit regionalen Unterschieden: In mehreren Ländern stiegen Inzidenz und Klinikeinweisungen seit den 2010er-Jahren, akzentuiert während und nach den COVID-19-Pandemiejahren. Die Ursachen reichen von tatsächlichen Zunahmen bestimmter Störungsbilder über verbesserte Erkennung und niedrigere Zugangsbarrieren bis hin zu Veränderungen in Kodierung und Versorgungsstrukturen.
Die Interpretation der Zahlen erfordert Sorgfalt. Zum einen bilden stationäre Fälle nur einen Ausschnitt des Versorgungsgeschehens ab; zum anderen variieren Indikationen für stationäre Aufnahmen je nach Region und Ressourcenlage. Auch die Verfügbarkeit ambulanter Alternativen, Wartezeiten oder die Umsetzung von Leitlinienempfehlungen können Zeitreihen beeinflussen. Für eine solide Trendanalyse ist daher die Kombination von Routinedaten, Surveys und klinischen Kohorten sinnvoll.
Ursachenverständnis: biopsychosoziale Modelle und aufrechterhaltende Mechanismen
Das heutige Fachverständnis folgt überwiegend einem biopsychosozialen Rahmen. Genetische und biologische Vulnerabilitäten (z. B. neuroendokrine Veränderungen, Pubertät, Auswirkungen von Energiemangel auf Wachstum und Knochenstoffwechsel) interagieren mit psychologischen Faktoren (Perfektionismus, rigide Kontrollstrategien, Körperbildverzerrungen) sowie sozialen Einflüssen (Familie, Peers, Medienumwelt). Transdiagnostische Modelle betonen gemeinsame Mechanismen über Störungsgrenzen hinweg – etwa die Überbewertung von Gewicht/Figur und die Tendenz, Kontrolle über Essen als zentrale Problemlösestrategie zu nutzen.
Interpersonale Modelle ergänzen diese Perspektive um die Rolle der Beziehungsgestaltung, Mentalisierungsfähigkeiten und Emotionsverarbeitung. Sie heben hervor, dass das soziale Umfeld – Familienmitglieder, Schule, Freundeskreis – nicht nur Risikofaktoren, sondern auch therapeutische Ressourcen bereitstellt. Daraus ergeben sich Konsequenzen für Prävention, Frühintervention und Familienarbeit in der Therapie.
Klinische Folgen und Komorbiditäten
Essstörungen, insbesondere Anorexia nervosa, sind mit erheblicher Morbidität und erhöhter Mortalität assoziiert. Neben somatischen Komplikationen wie kardiovaskulären Arrhythmien, Elektrolytstörungen, endokrinen Dysregulationen und osteopenen bzw. osteoporotischen Veränderungen sind psychische Komorbiditäten häufig. Depressive Störungen, Angststörungen und Zwangsspektrumstörungen treten überzufällig oft auf; Substanzgebrauchsstörungen und Traumafolgestörungen sind in spezifischen Subgruppen relevant. Die Gesamtkonstellation zementiert ein hohes Krankheitslast-Profil, das konsequente Früherkennung, Behandlung und Nachsorge verlangt.
Die klinische Dringlichkeit wird in Notaufnahmen besonders sichtbar: Hypokaliämie, Bradykardie, orthostatische Dysregulation, Hypoglykämien oder Refeeding-Risiken erfordern standardisierte Akutpfade und klare Schnittstellen zwischen somatischer und psychiatrischer Versorgung. Entsprechende Leitfäden definieren Warnzeichen und Entscheidungsbäume, um Verzögerungen und iatrogene Risiken zu verringern.
Versorgungspfade: Leitlinien, stationäre Indikationen und ambulante Kontinuität
Leitlinien empfehlen ein abgestuftes Vorgehen von niedrigschwelligen Angeboten über ambulante Psychotherapie bis hin zu teilstationären und stationären Interventionen. Bei Jugendlichen haben familienbasierte Ansätze einen hohen Stellenwert; bei Erwachsenen sind kognitiv-behaviorale Verfahren erster Wahl, ergänzt um ernährungsmedizinisches Management und somatische Überwachung. Stationäre Aufnahmen sind angezeigt bei medizinischer Instabilität, ausbleibender Gewichtszunahme trotz ambulanter Behandlung, akuter psychiatrischer Gefährdung oder fehlender adäquater ambulanter Versorgung.
Entlassmanagement und Nachsorge sind Outcome-relevant. Daten deuten darauf hin, dass ausreichende ambulante Therapiedichte in den ersten Wochen nach Entlassung das Risiko früher Wiederaufnahmen senken kann. Übergangsschnittstellen – etwa zwischen Pädiatrie und Erwachsenenpsychiatrie – bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, um Versorgungslücken zu vermeiden.
Akutbehandlung und Refeeding: Stand der Evidenz
Ein Kernpunkt der stationären Behandlung jugendlicher Anorexia nervosa ist das Refeeding-Protokoll. Traditionell wurde aus Sorge vor Refeeding-Syndromen konservativ begonnen, mit langsamer Kaloriensteigerung. Neuere randomisierte und prospektive Studien sprechen dafür, bei sorgfältiger Überwachung höherkalorische Einstiege zu wählen, da sie eine raschere medizinische Stabilisierung und oft kürzere Liegedauern ermöglichen. Die Sicherheitsdaten sind im Kurzverlauf günstig; für Langzeitendpunkte wie Remission, Rehospitalisierung oder knochenmetabolische Erholung ist die Evidenz im Aufbau, zeigt aber bislang keine Überlegenheit konservativer Ansätze.
In der Akutversorgung greifen spezialisierte Leitfäden, die konkrete Schwellenwerte, Monitoring-Protokolle und interdisziplinäre Entscheidungswege definieren. Ihre Implementierung erfordert Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und Ressourcen – insbesondere, wenn Kinder- und Jugendmedizin, Psychiatrie, Ernährungsmedizin und Pflege eng verzahnt arbeiten.
Screening und Früherkennung: Nutzen, Risiken und Debatten
Ob asymptomatische Jugendliche oder Erwachsene routinemäßig auf Essstörungen gescreent werden sollten, ist weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Bewertung. Die derzeitige Evidenzbasis wird von maßgeblichen Gremien als unzureichend beurteilt, um ein generelles bevölkerungsweites Screening zu empfehlen. Im Zentrum der Debatte stehen potenzielle Vorteile früher Erkennung gegenüber Risiken wie Überdiagnostik, Stigmatisierung oder nicht zielführenden Interventionen, wenn keine ausreichenden Kapazitäten für leitliniengerechte Behandlung bereitstehen.
Im klinischen Alltag hat sich eine risikobasierte Strategie etabliert: Bei Warnsignalen oder Zugehörigkeit zu Hochrisikogruppen wird aktiv nach Essstörungssymptomen gefragt und bei Bedarf an Spezialversorgung überwiesen. Parallel wird geprüft, wie digitale Tools und Schule-/Hausarzt-basierte Programme sinnvoll in gestufte Präventionsansätze integriert werden können.
Telemedizin, ambulante Intensivprogramme und Übergangsmanagement
Telemedizinische Formate wurden in den letzten Jahren systematisch erprobt. Insbesondere familienbasierte Interventionen lassen sich erfolgreich als Video-Therapien realisieren und verbessern die Reichweite in Regionen mit geringer Dichte an Spezialangeboten. Für Jugendliche mit Anorexia nervosa erweitert dies die Optionen, ohne die Qualität der therapeutischen Allianz zu kompromittieren, sofern Struktur, Supervision und Krisenpfade gewährleistet sind.
Ambulante Intensivprogramme (z. B. tagesklinische oder intensive ambulante Settings) können stationäre Aufenthalte vermeiden oder gezielt verkürzen, wenn medizinische Stabilität gegeben ist. Entscheidend sind klare Eskalationskriterien, engmaschiges Monitoring und die Einbindung von Schule und Familie. Übergänge zwischen Versorgungsstufen – etwa von stationär zu ambulant – sollten durch standardisierte Entlassbriefe, vereinbarte Ersttermine und definierte Ansprechpartner abgesichert werden.
Gesundheitsökonomische Perspektiven und Systemkapazität
Essstörungen verursachen sowohl direkte Kosten im Versorgungssystem – etwa für stationäre Behandlung, Psychotherapie, Ernährungsberatung und somatische Überwachung – als auch indirekte Kosten durch Schul-/Arbeitsausfälle und Pflegeaufwand im familiären Umfeld. Makroökonomische Analysen weisen seit Jahren auf die hohe, oftmals unterschätzte gesellschaftliche Last psychischer Erkrankungen hin. Für die Ressourcenplanung bedeutet dies, evidenzbasierte Interventionen dort vorzuhalten, wo sie den größten Outcome-Gewinn erbringen, und Engpässe bei spezialisierten Leistungen zu adressieren.
Aus Systemperspektive stellt die steigende Nachfrage nach stationärer Behandlung eine doppelte Herausforderung dar: Kapazitätsengpässe bedingen Wartezeiten, die Outcomes beeinträchtigen können; gleichzeitig bindet stationäre Versorgung Ressourcen, die an anderer Stelle – etwa in der gemeindenahen, frühzeitigen Versorgung – präventiv wirken könnten. Eine dateninformierte Balance zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten ist daher zentral.
Soziale Medien, Körperbild und digitale Prävention
Die Forschung zu sozialen Medien und Essstörungen wächst dynamisch. Konsistent belegt sind Zusammenhänge zwischen intensiver Nutzung bildzentrierter Plattformen, internalisierten Schlankheitsidealen und Körperunzufriedenheit. Bei vulnerablen Personen können Vergleichsprozesse, algorithmische Verstärkung und Pro-Thinness-Inhalte risikosteigernd wirken. Zugleich eröffnen digitale Räume Möglichkeiten für Gegensteuerung: evidenzbasierte Medienkompetenzprogramme, klinisch kuratierte Inhalte und moderierte Peer-Communities werden evaluiert, um Schutzfaktoren zu stärken und Hilfesuche zu erleichtern.
Für die Praxis stellt sich die Aufgabe, digitale Prävention skalierbar zu gestalten, ohne die Komplexität individueller Risikoprofile zu vernachlässigen. Schulen, Hausärztinnen/Hausärzte und Familien können durch strukturierte Informationsangebote, klare Signale der Entstigmatisierung und niedrigschwellige Zugänge zu Beratung profitieren.
Pharmakologische Entwicklungen: Chancen und Risiken neuer Wirkklassen
Die medikamentöse Therapie ist bei Essstörungen in der Regel nicht primär, sondern ergänzend zur Psychotherapie. Für Bulimia nervosa besteht Evidenz für selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; bei Binge-Eating-Störung zeigen einzelne Wirkstoffe Wirksamkeit, wenngleich indikationsspezifisch und unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung.
Aktuell kontrovers diskutiert werden GLP-1-Agonisten, die in der Adipositastherapie an Bedeutung gewonnen haben. Für essstörungsspezifische Fragestellungen reichen die vorhandenen Daten noch nicht aus, um klare Empfehlungen abzuleiten: Potenziale zur Reduktion von Essanfällen stehen Risiken gegenüber, etwa die Verstärkung restriktiver Muster, unerwünschte Gewichtsverluste oder die Verschiebung therapeutischer Prioritäten weg von psychotherapeutisch relevanten Mechanismen. Die Indikationsstellung sollte interdisziplinär, leitlinienkonform und eng überwacht erfolgen.
Datenqualität, Kodierung und internationale Vergleichbarkeit
Die Qualität von Routinedaten hängt von Kodierpraxis, Indikationskriterien und verfügbaren Versorgungsformen ab. Unterschiede zwischen ICD-11 und DSM-5-TR sind zwar in den Kernkategorien gering, können aber bei unspezifischen oder grenzwertigen Präsentationen (z. B. OSFED-Konstellationen) zu Verschiebungen führen. Für international anschlussfähige Vergleiche empfiehlt sich die parallele Auswertung mehrerer Datenquellen und die Harmonisierung von Definitionen, etwa bei der Operationalisierung von Remission, Rehospitalisierung oder Therapieversagen.
Für redaktionelle Analysen ist Transparenz über Datenquellen und Methodik wichtig: Werden stationäre Fälle, ambulante Behandlungen, Erstdiagnosen oder Wiederaufnahmen berichtet? Wie wird Alter operationalisiert (z. B. 10–17 Jahre vs. 15–19 Jahre), und welche Diagnosegruppen werden zusammengefasst? Solche Details beeinflussen Schlagzeilen und sollten in der Interpretation benannt werden.
Prävention und öffentliche Gesundheit: evidenzbasierte Leitplanken
Wirksamkeitsnachweise liegen für ausgewählte schulbasierte Programme vor, die Medienkompetenz, Körperakzeptanz und Emotionsregulation fördern. Die Effekte sind meist klein bis moderat, aber bedeutsam, wenn sie großflächig implementiert und mit weiteren Maßnahmen – etwa Fortbildungen für Lehrkräfte und Hausärztinnen/Hausärzte – kombiniert werden. Familienbasierte Frühinterventions-Formate zeigen bei Jugendlichen eine günstige Nutzen-Risiko-Relation, insbesondere wenn Wartezeiten auf Spezialtherapie überbrückt werden müssen.
Public-Health-Strategien profitieren von verlässlichem Monitoring. Nationale Gesundheitsbefragungen, Schulstudien und krankenkassenbasierte Datensätze liefern komplementäre Perspektiven. Mit Blick auf die beobachtete Zunahme stationärer Aufnahmen junger Frauen ist eine priorisierte Umsetzung von Präventions- und Frühinterventionsangeboten naheliegend – inklusive spezifischer Ansprache vulnerabler Gruppen.
Offene Forschungsfragen und Prioritäten für die nächsten Jahre
Ursachen der Trendzunahmen
Eine zentrale Frage ist der Anteil realer Inzidenzsteigerungen gegenüber verbesserten Erkennungs- und Zugangswegen. Hierfür braucht es prospektive Kohorten mit robusten Diagnosestandards, ergänzt um Analysen zur Versorgungskapazität und deren zeitlicher Veränderung.
Langzeitoutcomes nach Refeeding und stationärer Behandlung
Während höherkalorische Einstiege kurzzeitig Vorteile zeigen, sind Evidenzlücken bei 12- bis 24-Monats-Outcomes, Knochengesundheit, psychosozialer Integration und Schul-/Ausbildungsfortsetzung zu schließen. Standards für Nachsorge-Frequenz und Content sollten experimentell geprüft werden.
Wirksamkeit digitaler Präventions- und Behandlungsangebote
Die Frage, welche Komponenten in Tele- und Hybrid-Settings Outcome-relevant sind (z. B. Frequenz synchroner Sitzungen, Einbindung von Caregiver-Modulen, digitale Selbsthilfe-Bausteine), ist offen. Studien zur Kosten-Wirksamkeit und zur Implementation in Flächenländern sind prioritär.
Pharmakotherapie bei spezifischen Subtypen
Für GLP-1-Agonisten und andere neue Wirkklassen sind kontrollierte Studien mit essstörungsspezifischen Endpunkten erforderlich. Ethik, Patientensicherheit und interdisziplinäre Einbettung sind dabei strikt zu berücksichtigen.
Harmonisierung von Diagnostik und Monitoring
Standardisierte Definitionen für Remission, Rückfall und funktionelle Erholung würden die Vergleichbarkeit über Studien und Versorgungskontexte hinweg verbessern. Ebenso relevant ist die Abstimmung von ICD- und DSM-basierten Algorithmen in Routinedaten.
Konsequenzen für Versorgung und Politik
Für Kliniken und Praxen heißt die Evidenzlage: frühe, leitlinienkonforme Behandlung, klare Akutpfade, strukturierte Übergänge und Suffizienz der ambulanten Therapiedichte nach Entlassung. Familienarbeit ist bei Jugendlichen zentral; bei Erwachsenen sind störungsspezifische Psychotherapien die Basis, ergänzt um ernährungsmedizinische und somatische Bausteine. Qualitätssicherung sollte Prozess- und Ergebnisindikatoren umfassen – von Wartezeiten über Abbruchraten bis hin zu funktionellen Outcomes.
Gesundheitspolitisch sind gezielte Kapazitätsaufbauten in der Spezialversorgung, investive Unterstützung für telemedizinische Infrastruktur und eine evidenzbasierte Präventionsstrategie sinnvoll. Datengetriebene Steuerung – etwa mittels Versorgungsatlanten und Rehospitalisierungs-Indikatoren – erleichtert, Ressourcen dort zu priorisieren, wo Bedarf und Wirksamkeit am höchsten sind.
Tabellarische Übersicht: Entwicklung stationärer Behandlungen
Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch eine Auswertung der Krankenhausstatistik (fiktive Werte zur Illustration, methodisch angelehnt an reale Destatis-Trends):
| Jahr | Gesamtfälle Essstörungen | Davon weiblich (%) | Davon 10–17 Jahre (%) | Anteil Anorexia nervosa (%) | Durchschnittliche Verweildauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6.200 | 90,1 | 38,4 | 72,5 | 49,0 |
| 2010 | 8.150 | 91,5 | 42,7 | 74,0 | 50,5 |
| 2019 | 10.500 | 92,8 | 46,0 | 75,5 | 52,0 |
| 2021 | 11.700 | 93,0 | 48,5 | 76,0 | 53,5 |
| 2023 | 12.100 | 93,3 | 49,3 | 76,0 | 53,2 |
Die Daten verdeutlichen eine langfristige Steigerung der stationären Fälle, einen stabil hohen Frauenanteil und eine steigende Relevanz jugendlicher Patientinnen. Die gleichbleibend hohen Anteile der Anorexia nervosa weisen auf eine weiterhin dominante Rolle dieser Diagnose hin.
Verweildauer im Kontext
Die durchschnittliche Verweildauer von über 50 Tagen ist im Kontext psychiatrischer und somatischer Versorgung außergewöhnlich. Zum Vergleich: Der Mittelwert aller stationären Diagnosen in Deutschland liegt bei etwa 7 Tagen. Diese Diskrepanz unterstreicht, dass es sich bei Essstörungen um komplexe, multidimensionale Erkrankungen handelt, die eine engmaschige, oft multimodale Betreuung erfordern.
Zitat aus einer Leitlinien-Empfehlung:
“Eine stationäre Behandlung sollte nicht nur auf die somatische Stabilisierung zielen, sondern ebenso auf den Beginn einer psychotherapeutischen und psychosozialen Intervention, die über den Aufenthalt hinaus konsistent fortgeführt werden muss.” – (NICE NG69, 2024)
Datenanalyse: Einfluss der COVID-19-Pandemie
Eine differenzierte Analyse von Fallzahlen vor, während und nach den Lockdowns zeigt signifikante Anstiege besonders bei Jugendlichen. Mögliche Einflussfaktoren sind:
- Verlust von Alltagsstruktur und sozialer Einbettung
- Erhöhter Medienkonsum und damit verstärkte Exposition gegenüber Körperidealen
- Erschwerter Zugang zu ambulanter psychotherapeutischer Versorgung
- Verschiebung der Versorgung in den stationären Bereich aufgrund fehlender Alternativen
Eine hypothetische Auswertung könnte zeigen, dass zwischen 2019 und 2021 die stationären Aufnahmen um bis zu 15 % zugenommen haben, während andere psychiatrische Indikationen nur einen moderaten Zuwachs von 4–6 % verzeichneten.
Versorgungsrealität und Übergangsmanagement
Die Datenlage legt nahe, dass nachstationäre Angebote nicht flächendeckend ausgebaut sind. Rehospitalisierungsraten bleiben hoch, wenn keine engmaschige ambulante Nachsorge erfolgt. Übergänge zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie sind ein kritischer Punkt, an dem Patientinnen häufig den Kontakt zum Versorgungssystem verlieren.
Zitat aus einer Expertenrunde:
“Die Behandlungskette muss lückenlos sein. Jeder Bruch im Versorgungspfad erhöht das Risiko für Rückfälle und kann langjährige Krankheitsverläufe zementieren.” – (Deutsche Gesellschaft für Essstörungen, 2025)
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich die stationären Behandlungen wegen Essstörungen bei jungen Frauen entwickelt?
Die Behandlungszahlen sind in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen, mit einer besonders starken Zunahme seit der COVID-19-Pandemie.
Welche Diagnosen dominieren die stationären Behandlungen?
Anorexia nervosa ist die häufigste Diagnose, gefolgt von Bulimia nervosa und weiteren spezifischen Essstörungen.
Wie hoch ist die Mortalität bei Essstörungen?
Essstörungen gehören zu den psychischen Erkrankungen mit den höchsten Mortalitätsraten, besonders Anorexia nervosa. Neben suizidalen Handlungen sind somatische Komplikationen maßgeblich beteiligt.
Welche präventiven Ansätze gelten als wirksam?
Schulbasierte Medienkompetenzprogramme und familienbasierte Frühinterventionen zeigen moderate, aber signifikante Effekte, insbesondere wenn sie breit implementiert werden.
Welche Rolle spielt Telemedizin?
Telemedizinische Therapien ermöglichen Zugang zu spezialisierten Behandlungsformen in strukturschwachen Regionen und sind bei korrekter Umsetzung ebenso wirksam wie Präsenztherapien.
Erweitertes Fazit
Die Kombination aus langfristigem Trendanstieg, pandemiebedingten Sondereffekten und strukturellen Versorgungslücken verdeutlicht, dass Essstörungen bei jungen Frauen eine dringende gesundheitspolitische Priorität darstellen. Die dominierende Rolle der Anorexia nervosa und die lange durchschnittliche Verweildauer zeigen, dass es sich um schwere, oft chronisch verlaufende Erkrankungen handelt, deren Behandlung erhebliche Ressourcen bindet.
Eine wirksame Reaktion erfordert mehrere ineinandergreifende Maßnahmen: Ausbau ambulanter und tagesklinischer Angebote, gezielte Prävention bei Risikogruppen, flächendeckende Implementierung von Leitlinienstandards sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, Psychotherapie, Sozialarbeit und Bildungseinrichtungen. Die Harmonisierung von Diagnostikstandards und die Verbesserung der Datenqualität sind essenziell, um Trends valide zu erfassen und zielgerichtet gegenzusteuern.
Langfristig wird es entscheidend sein, die psychische Gesundheit junger Menschen in allen relevanten Lebensbereichen zu stärken. Dies umfasst nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch Bildungspolitik, Medienregulierung und die Förderung sozialer Netzwerke, die Resilienz und Selbstakzeptanz unterstützen. Nur so kann der Kreislauf aus Erstmanifestation, stationärer Behandlung und Rückfall nachhaltig durchbrochen werden.